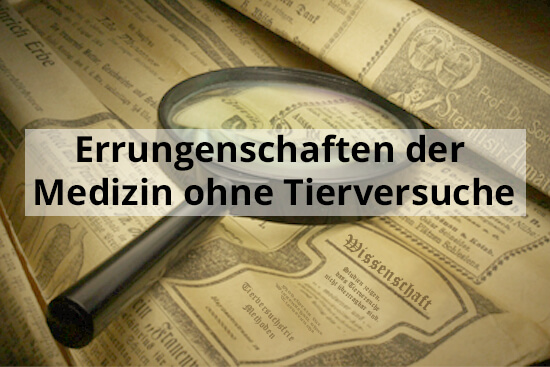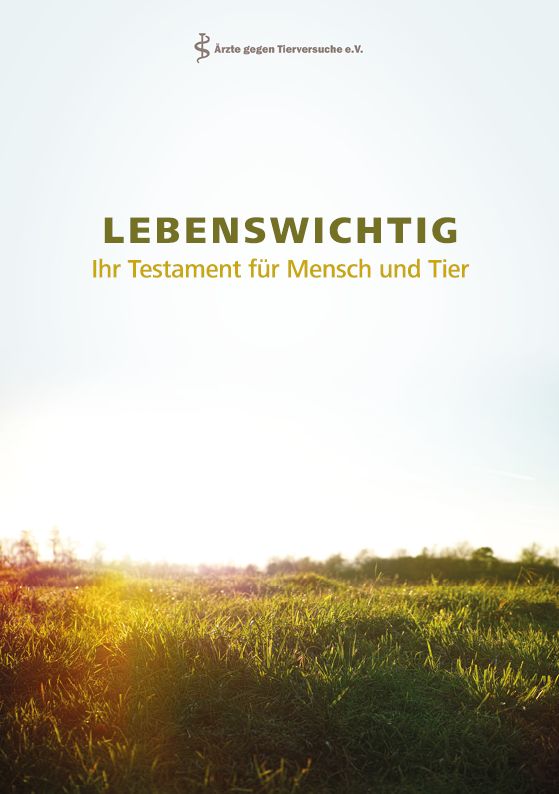Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!
Mit unserem Newsletter informieren wir Sie gern ca. zweimal monatlich über unsere Aktionen, Ihre Unterstützungsmöglichkeiten und natürlich unsere Erfolge. Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich in unseren Newsletter-Verteiler aufgenommen. (Weiter Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen)
Newsletter anmelden
Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein, wenn Sie unseren Newsletter beziehen möchten und klicken Sie dann auf „Anmelden“.
Sie können Ihrem Einverständnis zur Verwendung Ihrer Daten für die Übersendung unseres Newsletters jederzeit per E-Mail, Post, Telefon oder Telefax widersprechen. Bei einem Widerspruch über Telefon oder Telefax entstehen dabei maximal Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Telefonanbieters, Mehrwertdienstrufnummern werden unsererseits nicht verwandt.
Widerspruch gegen den Erhalt unseres Newsletters können Sie auch in jedem Newsletter selbst erheben. Auf dabei eventuell über Ihren Internetprovider entstehende Kosten haben wir keinen Einfluss.
Newsletter abmelden
Für den Fall, dass Sie unseren Newsletter nicht mehr beziehen möchten, steht Ihnen in jedem Newsletter ein Abmeldelink für eine Abmeldung zur Verfügung, auf den Sie klicken können – damit erfolgt die sofortige Abmeldung von dem Newsletter.
Hier folgt ein Artikel..
Der Tierversuch in der Diabetes-Forschung - genauer betrachtet!
In Informationsbroschüren der Pharmaindustrie oder bei Diskussionen zum Thema Tierversuch wird auffällig oft das Beispiel »Diabetes mellitus« bemüht, um vermeintliche medizinische Fortschritte durch Tierversuche zu benennen. Eine genauere Darlegung, wie und wann nun im einzelnen bestimmte Tierversuche angeblich zu verwertbaren Ergebnissen für die Humanmedizin geführt haben, bleibt aus. Bestenfalls erinnert sich noch der eine oder andere an zwei Kanadier, die „Helden“ der so genannten „Insulin-Story“, die auch irgendwie Experimente mit Hunden durchgeführt haben…
Das ist aber doch viel zu wenig, um behaupten zu können, Diabetiker hätten Tierversuchen ihr Leben zu verdanken bzw. die Erfolge der Diabetesforschung würden auf Tierversuchen basieren!
Mit der hier vorliegenden Ausarbeitung soll folgendes genauer aufgezeigt werden:
- Der zeitliche Umfang und die Komplexität der Erforschung des Diabetes mellitus und
- Die ernüchternde (bis hinderliche) Rolle, die der Tierversuch in diesem Zusammenhang spielte.
Der erste Teil zeigt die Erkenntnisse auf, die letztlich zur Lösung des Rätsels Diabetes führten. Da die Auflistung chronologisch nach geschichtlichen Daten erfolgt, erscheinen die inhaltlichen Bereiche natürlich etwas verstreut. Die Diabetes-Geschichte ist aber auch ein großes Mosaik, das sich aus vielen verschiedenen Steinchen zusammensetzt.
Die Geschichte der Erforschung und Behandlung des Diabetes mellitus im Überblick
1550 v.Chr.
Papyrus Ebers (Ägypten):
- Beschreibung des Krankheitsbildes.
- Symptom des »übermäßigen Harnflusses« bereits bekannt.
- Haferschleimdiät als Therapie.
3. Jahrhundert v.Chr.
Altindische Sanskritmedizin:
- Symptomatik der Ketonkörperbildung und des Diabetischen Komas beschrieben.
- Zucker im Urin als Symptom bekannt („Zuckerharnruhr“ und „Honigharn“ als Krankheitsbezeichnung).
- Demetrius v. Apamaia nennt die Krankheit „Diabetes“.
81-138 n.Chr.
Aretaios v. Kappadokien liefert ausgezeichnete Krankheitsschilderungen:
- Hauptsymptome beschrieben.
- Diätvorschriften
Um 1520
Paracelsus (1493-1541) lenkt Augenmerk auf Stoffwechsel:
- Erhält beim Eindampfen von Urin (Zucker-)Rückstände, die er »Salze« nennt.
- Vermutete, dass diese auch im Blut vorhanden sind.
- Der bis zu dem Zeitpunkt in Europa vorherrschende Glaube an die Lehren des Arztes Galen, Diabetes sei eine Nierenschwäche, wurde hier zum erstenmal angezweifelt.
Um 1540
Guillaume Rondelet (1507-1566) weist auf erbliche Komponente des Diabetes hin.
1674
Thomas Willis (1622-1675) »entdeckt« als erster Europäer den (durch Zucker hervorgerufenen) süßen Geschmack des Diabetiker-Urins.
1711
Valentini stellt fest, dass der (durch Ketonkörper hervorgerufene) Urin- und Körpergeruch des Diabetikers identisch sind.
1767
Der französische Pathologe Joseph Lieutand (1703-1780) stellt bei Sektionen von Diabetikern Veränderungen der Bauchspeicheldrüsen fest.
1775
Der französische Arzt Théophile de Bordeu (1722-1776) vermutet, dass Organe auch Stoffe direkt in das Blut abgeben können. (Anfänge der Hormonforschung)
1776
Der Liverpooler Arzt Matthew Dobson (1735-1784) experimentiert mit Diabetiker-Urin und -Blut:
- Gewann Zucker aus den Flüssigkeiten.
- Führte die Vergärung des Urins als diagnostische Methode ein.
- Erkannte, dass der Zucker aus dem Blut in den Urin gelangt.
- Erkannte ebenfalls, dass auch gesunde Menschen Zucker im Blut haben (nur entsprechend weniger).
1780
Francis Home (1719-1813) entwickelt Gärungsprobe weiter.Thomas Cawley findet bei Sektion eines im Koma gestorbenen Diabetikers Pankreassteine (Pankreas = Bauchspeicheldrüse).
1802
Blutzuckerbestimmung durch Nicolas und Gueudeville.
1833
Richard Bright (1789-1858) vermutet aufgrund von Sektionsbefunden direkten Zusammenhang zwischen Pankreasveränderungen und Diabetes.
Der amerikanische Militärarzt William Beaumont beschreibt die Funktion der Bauchspeicheldrüse bei der Verdauung und vermutet ebenfalls auch eine hormonelle Funktion dieses Organs.
1838
Chemisch fundierte Bestätigung der Identität von Harn- und Traubenzucker durch A. Bouchardat (1806-1886) und Eugène Melchior Péligot (1811-1890).
1842
William Prout (1785-1850) machte Beobachtungen wie später Kußmaul (s.u.).
1852
Der französische Apotheker, Hygieniker und Chemiker A. Bouchardat (s.o.) postuliert enge Beziehung von Pankreaserkrankungen zum Diabetes.
1857
Petters weist Aceton im Urin nach.
1861/1862
Theodor Friedrichs (1819-1885) und George Hardley (1829-1896) finden Pankreaszysten und -abszesse bei Diabetikern.
1864
Jos. Alexander Fles (1819-1905) findet bei Sektion eines Diabetikers eine Pankreasschrumpfung und führt die Krankheit darauf zurück. Therapieversuche mit oral zugeführtem Pankreas.
Friedrich Daniel v. Recklinghausen (1833-1910) und T. A. Hartsen berichten über zwei Fälle von Diabetes mit Pankreasverfettung.
1869
Paul Langerhans (1847-1888) schreibt Doktorarbeit über die mikroskopische Anatomie des Pankreas: Beschreibt u.a. die (Insulin produzierenden) Inselzellen, die später auch nach ihm benannt werden, kann sich aber ihre Funktion noch nicht erklären.
1870
Edwin Klebs (1834-1913) und Herrmann Munk (1839-1912) beobachten einen Fall von Diabetes, bei dem kein Pankreasgewebe mehr vorhanden war.
1873
Alexander Sylver und Erich Harnack (1852-1915) beobachten ebenfalls Pankreasveränderungen bei Diabetikern.
1874
Adolf Kußmaul (1822-1902) beobachtet am Krankenbett die Atmung des Diabetikers im Endstadium (Diabetisches Koma), beschreibt diesen Atmungstyp und führt ihn auf die Blutübersäuerung zurück: Dieser Atmungstyp wird daher auch „Kussmaul-Atmung“ genannt.
1875
Nikolaus Friederich (1835-1882) publiziert Fälle von Diabetes mit Pankreasveränderungen.
1877
Lancéreaux prägt den Begriff „Diabète pancréatique“.
1879
Hermann Senator (1834-1911) meldet Sektionsbefunde mit Pankreasveränderungen.
Lapière meldet 65 Fälle von Diabetes mit Pankreasveränderungen.
1881
Der Arzt Leopold Baumel vertritt die Ansicht, dass jeder Diabetes auf Pankreasveränderungen zurückzuführen ist.
1884
Frerichs weist ebenfalls 12 Sektionsbefunde vor, die o.g. These untermauern.
1885
Max Einhorn (1862-1953) entwickelt das noch heute gebräuchliche Gärungssaccharometer für Urin-Diagnostik.
1893
Edouard Laguesse (1861-1927) benannte die Inselzellen des Pankreas nach ihrem Erstbeschreiber Langerhans und vermutete, dass diese ein Hormon erzeugen.Joseph Seegen (1822-1904)
Sektionsbefunde wie oben.Fernando Battistini (1867-1929) injizierte zwei Diabetikern einen Pankreasextrakt und konnte eine Besserung erzielen.
1894
David Hansemann (1858-1920) berichtet, dass eine Schrumpfung des Pankreas zu Diabetes führte: Er beschreibt 40 ähnliche Fälle.
1895
Christian Dieckhoff beschreibt 53 Fälle von Diabetes mit Fehlen oder Verringerung der Inselzellen.
1898
Naunyn prägt den Begriff »Azidose« für die Blutübersäuerung und macht diese für das diabetische Koma verantwortlich.
1899
Vincenco Diamare (1872-1960) erkannte zwei Zelltypen der Inselzellen. Diese wurden später A- und B-Zellen genannt.
1901/1902
Weitere Sektionsbefunde, die keinen Zweifel mehr an der Richtigkeit der „Pankreastheorie“ („Diabète pancréatique“) zuließen.
Michel Gentes (1872-1921) widerlegt die These, dass die Inselzellen lymphatisch sein. Er beobachtete Fälle von Leukämie, bei denen die Inselzellen unversehrt blieben.
1907
Franz Knoop (1875-1946) weist Beta-Oxydation der Fettsäuren nach. Die Acetonkörper im Diabetiker-Blut wurden somit als Resultat eines gestörten Energiestoffwechsels erkannt.
1908
Prof. Georg Ludwig Zülzer (1870-1949) führte Behandlungsversuche mit Injektionen von Pankreasextrakten bei Patienten durch: Der Blutzuckerspiegel sank zwar, aber der Extrakt enthielt noch zu viele Verunreinigungen, so dass es zu Zwischenfällen kam. Zülzer musste seine Arbeit aufgeben.
1909
Der Belgier Jean de Meyer prägt den Namen „Insulin“ für den vom Pankreas produzierten Stoff, den Diabetiker für die Regulierung des Zuckerhaushalts benötigen, und vermutete, dass Insulin ein Hormon ist.
1921
Dem kanadischen Arzt Frederick Grant Banting (1891-1941) und seinem Landsmann, dem Physiologie- und Biochemie-Student Charles Herbert Best (geb.1899) gelang es, aus Pankreasgewebe durch Alkoholauszug einen gereinigten Extrakt zu gewinnen (das so genanntes „Toronto-Verfahren“):
- Die Verträglichkeit dieser kleinen Chargen testeten die Forscher im Selbstversuch.
- Die Wirksamkeit der Extrakte wurde an einem diabetischen Kollegen, dem Arzt Dr. Gilchrist, geprüft.
1942
Bei der Sulfonamid-Behandlung von Thyphus - Patienten wird zufällig entdeckt, dass als Nebenwirkung eine Unterzuckerung auftritt.
1955
Selbstversuche mit Sulfonamiden durch Prof. Hans Franke (1909-1955) und Dr. Joachim Fuchs:
Es war wiederum das Symptom Unterzuckerung festzustellen.
Dies war der Anfang der oralen Therapie-Möglichkeit des Diabetes Typ 2 mit Sulfonamiden.
Tierversuche in der Diabetesforschung
1682
Der Schweizer Arzt und Physiologe Johann Conrad Brunner (1653-1727) führt so genannte „Extirpationsversuche“ mit einem Hund durch:
- Er schneidet dem Tier (ohne Narkose!) einen Großteil des Pankreas heraus und beobachtet an den folgenden Tagen, welche Symptome auftreten.
- Tatsächlich zeigt der Hund alle drei Hauptsymptome des Diabetes (viel Wasser lassen, Durst und Heißhunger).
- Brunner beschreibt diese Symptome ganz ausführlich in seinem Versuchsprotokoll, ohne zu merken, dass er das Krankheitsbild des Diabetes beschreibt!
- Brunners fatale Schlussfolgerung: Die Bauchspeicheldrüse hat keine Funktion!
1849
Der französische Physiologe Claude Bernard (1813-1878) löste bei Versuchstieren durch Nadelstiche in das Gehirn eine vorübergehende Zuckerausscheidung über die Nieren aus:
- Damit glaubte er bewiesen zu haben, dass der Sitz des Diabetes das die Blutgefäße versorgenden Nervensystems sei und verbreitete die These von der „Diabète nerveuse“ (auch „Angioneurotischer Diabetes“ genannt).
- Noch bis zur Jahrhundertwende haben die Anhänger Bernards an dieser Irrlehre festgehalten und verzögerten damit den Durchbruch der richtigen Theorie vom „Pankreas-Diabetes“!
1889
Joseph v. Mehring (1845-1908) und Oscar Minkowski (1858-1931) führten ebenfalls Extirpationsversuche an Tieren durch:
- Diese Versuche waren aber nur eine Bestätigung für die längst durch klinische Beobachtung gewonnene Erkenntnis, dass der Sitz der Krankheit im Pankreas ist.
Um 1920
Die Kanadier Banting und Best demonstrierten an der Hündin „Marjorie“, dass bei fehlenden Inselzellen eine Insulintherapie den Blutzuckerspiegel im Lot hält.
- Auch das war keine neue Erkenntnis, sondern lediglich ein Beweis für die Richtigkeit Prof. Zülzers Vorstellungen von einer geeigneten Therapie.
Zusammenfassung und Bewertung der Fakten
Alle brauchbaren Erkenntnisse, die den „roten Faden“ in der Diabetes-Geschichte von der Antike bis in unser Jahrhundert bilden, basieren auf tierversuchsfreien Methoden!
Tierexperimente haben
- zu keiner neuen Erkenntnis geführt,
- Bestenfalls eine auf anderem Wege gewonnene Erkenntnis in ihrer Reproduzierbarkeit gezeigt, und
- insgesamt gesehen der Diabetesforschung eher geschadet als genützt, da sie Anlass zu falschen Theorien gaben.
Hätte man Experimentatoren wie Brunner und Bernard bis heute geglaubt, gäbe es noch immer nicht die Insulintherapie!
Die Behauptung von Tierversuchsbefürwortern, Tierversuche hätten die entscheidende Rolle bei der Entdeckung des Insulins gespielt, entspricht nicht den Tatsachen.
Banting und Best sind nicht
- die einzigen Diabetesforscher, die es je gab,
- die Entdecker des Insulins und dessen Wirkung
- sondern sie haben lediglich auf die über Jahrtausende mühselig zusammengetragenen Erkenntnisse unzähliger Vorgänger das „i-Tüpfelchen“ gesetzt; indem sie das geeignete Extraktionsverfahren, welches Insulin in gereinigter Form herstellbar machte, entwickelten.
Dr. med. vet. Cristeta Brause
20.05.2004
Twingle-Test:

Ihre Spende ist uns wichtig!
Weitere Infos können hier stehen...
Link-Test:
Pressekontakt & Akkreditierung
Unsere Ansprechpartnerin für die Medien
Dr. med. vet. Gaby Neumann
Tel.: 02204 99902-20
E-Mail: presse@aerzte-gegen-tierversuche.de
Ihre Abfrage
5694 Ergebnisse wurden gefunden
Dokument 1
Titel: Eine systematische Analyse des durch Ernährung hervorgerufenen Nierenschutzes zeigt überlappende und konservierte Veränderungen im Cystein-KatabolismusHintergrund: Der Einfluss von 5 verschiedenen Ernährungsmustern auf Nierenschäden nach künstlich ausgelöster Minderdurchblutung der Nieren wird für Mäuse untersucht.
Tiere: 160 Mäuse (ca.)
Jahr: 2022
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) unter der Nummer TVA2019.A345 genehmigt. Die männlichen Mäuse der Zuchtlinie C57BL6N werden von der Firma Janvier Labs, Paris, Frankreich, bezogen. Sie sind zu Beginn der Experimente 8 Wochen alt und werden einzeln gehalten, was für die sozialen Tiere allein schon Stress bedeutet.
Die Tiere werden in acht Gruppen aufgeteilt. Fünf Gruppen von Mäusen erhalten Futter mit unterschiedlicher Kalorienzufuhr und zum Teil reduziertem Anteil an Kohlehydraten oder bestimmten Aminosäuren. Gruppe 6 erhält nur 70 % der normalen Futtermenge. Gruppe 7 und 8 werden normal ernährt.
Nach 14 Tagen mit dieser Ernährung werden alle Mäuse der Gruppen 1-7 unter Narkose operiert. Der Bauch wird in der Mitte aufgeschnitten und eine Niere wird herausgeschnitten. Bei der zweiten Niere wird die Blutzufuhr für 40 Minuten abgeklemmt. Dann wird die Klemme geöffnet und es wird beobachtet, wie das Blut in die Niere zurückströmt. Danach wird die Bauchdecke zugenäht. Die Tiere erhalten ein Schmerzmittel unter die Haut injiziert. In den folgenden Tagen bekommen alle Mäuse normales Futter in normaler Menge.
Die Mäuse der Gruppe 8 werden scheinoperiert, d.h., es wird eine Niere herausoperiert, aber die zweite Niere wird nicht abgeklemmt. Ansonsten wird genauso verfahren wie bei den Operationen der anderen Mäuse.
In drei Gruppen sterben bis zu 70 % der Mäuse innerhalb von 72 Stunden. 24 oder 72 Stunden nach der Operation werden jeweils einige Mäuse aus jeder Gruppe getötet. Die Tötung erfolgt unter Narkose ohne nähere Angabe. Eine Blutprobe wird aus dem Herzen entnommen und die Niere wird herausgeschnitten und untersucht.
Es werden auch Urin- und Blutproben von Patienten untersucht, die an einer Studie mit unterschiedlicher Nahrungszusammensetzung teilnehmen.
Bereich: Ernährungswissenschaft, Altersforschung
Originaltitel: A systematic analysis of diet-induced nephroprotection reveals overlapping and conserved changes in cysteine catabolism
Autoren: Felix C. Koehler (1,2,3), Chun-Yu Fu (4), Martin R. Späth (1,2), K. Johanna R. Hoyer-Allo (1,2), Katrin Bohl (1,2,3), Heike Göbel (5), Jan-Wilm Lackmann (2), Franziska Grundmann (1), Thomas Osterholt (1), Claas Gloistein (1), Joachim D. Steiner (1,6), Adam Antebi (6), Thomas Benzing (1,2,3), Bernhard Schermer (1,2,3), Günter Schwarz (3,4)*, Volker Burst (1), Roman-Ulrich Müller (1,2,3)*
Institute: (1)* Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II, Universitätsklinikum Köln, Universität zu Köln, Kerpener Str. 62, 50937 Köln, (2) CECAD, Universitätsklinikum Köln, Universität zu Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 26, 50931 Köln, (3) Zentrum für Molekulare Medizin Köln (CMMC), Universität zu Köln, Köln, (4) Institut für Biochemie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln, Köln, (5) Diagnostik und Experimentelle Nephrologie, Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Köln, Universität zu Köln, Köln, (6) Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns, Köln
Zeitschrift: Translational Research 2022; 244: 32-46
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5815
Dokument 2
Titel: Nicht-tödliche Blutentnahme beim Türkisen Prachtgrundkärpfling Nothobranchius furzeriHintergrund: Anleitung für die Blutentnahme bei einem Fisch, der aufgrund seiner kurzen Lebensspanne für die Altersforschung verwendet wird, um den Geheimnissen des Alterns auf die Spur zu kommen.
Tiere: Fische (Anzahl unbekannt)(Türkise Prachtgrundkärpflinge)
Jahr: 2023
Versuchsbeschreibung: Der Türkise Prachtgrundkärpfling ist ein 6 cm langer in Simbabwe vorkommender Fisch mit einer extrem kurzen Lebenserwartung. Die Tiere zeigen bereits im Alter von 3 Monaten Alterserscheinungen und sterben mit 3-4 Monaten. Die kurze Lebensspanne ist eine Anpassung an den Lebensraum, da die Tümpel, in denen der Fisch lebt, schnell austrocknen. Da die Tiere sozusagen in Zeitraffer altern, sind sie zu einem „beliebten Forschungsobjekt“ im Bereich der Altersforschung geworden.
Der Artikel ist eine Anleitung für die Blutentnahme beim Prachtgrundkärpfling, bei der eine Tötung vermieden wird. Der Fisch wird in eine Plastikbox mit einem Anästhetikum gesetzt. Wenn er betäubt ist, nimmt man ihn aus dem Wasser und legt ihn auf die Seite unter ein Mikroskop. Im Bereich des Schwanzflossenansatzes wird mit einer Pinzette eine Schuppe entfernt. Eine Nadel wird durch die Haut gestochen und Blut mit einer Spritze angesaugt. Der Fisch wird in Wasser ohne Anästhetikum gesetzt, wo er nach wenigen Minuten aufwacht. Die Stichwunde soll nach einer Woche verheilt sein. Laut Autoren kann man von einem Fisch mehrfach Blut nehmen; empfohlen wird frühestens nach einem Monat. Ebenfalls wird erwähnt, dass man die gleiche Blutentnahmestelle erneut nehmen kann oder die andere Seite des Fisches.
Die Arbeit wurde unterstützt durch den Europäischen Forschungsrat und das EU-Horizon-Programm.
Bereich: Altersforschung
Originaltitel: Nonlethal blood sampling from the Killifish Nothobranchius furzeri
Autoren: Luca Dolfi (1), Roberto Ripa (1), Danel Medelbekova (1), Eugen Ballhysa (1,2), Orsolya Symmons (1), Adam Antebi (1,2)*
Institute: (1) Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns, Joseph-Stelzmann-Straße 9B, 50931 Köln, (2) Cologne Excellence Cluster on Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases (CECAD), Universität zu Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 26, 50931 Köln
Zeitschrift: Cold Spring Harbor Protocols 2023; 2023(8):107745
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5814
Dokument 3
Titel: Die NPY-vermittelte synaptische Plastizität in der erweiterten Amygdala priorisiert die Nahrungsaufnahme während des HungersHintergrund: Es soll der Zusammenhang zwischen Angstverhalten und Hunger und die Rolle eines bestimmten Proteins untersucht werden.
Tiere: Mäuse (Anzahl unbekannt)
Jahr: 2024
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Eine Genehmigungsnummer wird nicht genannt. Es werden Mäuse 7 verschiedener genmanipulierter Linien von der Zuchtfirma Jackson Laboratories bezogen. Nicht genmanipulierte Mäuse der Zuchtlinie C57Bl/6 stammen von der Zuchtfirma Charles River. Bei beiden Firmen werden Ort und Land nicht genannt. Genmanipulierte und „normale“ Mäuse werden miteinander verpaart – üblicherweise geschieht dies über mehrere Generationen, um Mäuse mit den gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Den Tieren fehlen ein oder mehrere Gene.
Bei einigen Mäusen wird unter Narkose der Kopf in ein stereotaktisches Gestell eingespannt. Die Kopfhaut wird aufgeschnitten und es wird ein Loch in den Schädel gebohrt. Bei einigen Tieren werden an zwei Stellen Viren in das Gehirn gespritzt; diese dienen als Vektoren, um bestimmte Gene zu verändern. Bei anderen Mäusen werden zwei Lichtfasern in das Gehirn eingelassen und mit Zahnzement am Schädelknochen befestigt. Die Mäuse dürfen sich nach der Operation 1-3 Wochen erholen.
Während der folgenden Experimente werden die Mäuse einzeln in Käfigen gehalten, was allein schon Stress für die sozialen Tiere bedeutet. Sie werden täglich gehändelt, um sie daran zu gewöhnen, angefasst zu werden.
Mit dem Elevated O-Maze (Null-Labyrinth) wird das Angstverhalten der Tiere untersucht. Die Apparatur besteht aus einer auf 40 cm hohen Beinen stehenden kreisförmigen Plattform von 50 cm Durchmesser. Die runde Laufbahn ist 5 cm breit und weist zwei offene Bereiche auf und zwei Bereiche, die mit 14 cm hohen Wänden ausgestattet sind. Mäuse meiden normalerweise die offenen Bereiche und halten sich lieber in den geschützten, seitlich geschlossenen auf. Nach 16 Stunden Fasten wird eine Maus in das Null-Labyrinth gesetzt. Dabei wird jeweils ein Futterpellet oder ein Objekt (Hobelspäne) in die offenen Bereiche gelegt. Es wird untersucht, ob der Hunger stärker ist als die Angst, sich in den offenen Bereich zu wagen. Jede Maus durchläuft den Test 4 Mal mit den 4 verschiedenen Parameter: gefastet oder nicht gefastet, Hobelspäne oder Futterpellet.
Bei den Mäusen mit den Lichtfasern im Gehirn werden diese mit einem Kabel verbunden. Das Licht der Faser wird angeschaltet, um bestimmte Nervenzellen im Gehirn zu stimulieren, während die Maus sich im Null-Labyrinth befindet. Bei weiteren Mäusen wird die Lichtfaser angeschaltet und bis zu 5 Stunden lang gemessen, wie viel die Tiere essen. Bei anderen Mäusen wird über eine in das Gehirn einoperierte Kanüle eine Chemikalie in das Gehirn eingeleitet, die bestimmte Nervenzellen stimulieren soll. Auch bei diesen Mäusen wird das Nahrungsaufnahmeverhalten beobachtet.
Am Ende der Experimente werden die Mäuse narkotisiert und entweder durch Köpfen getötet oder eine konservierende Lösung wird in die Blutbahn injiziert. Dadurch sterben die Tiere. Ihre Gehirne werden untersucht, ob die Fasern an der richtigen Stelle gesessen haben.
Die Arbeit wurde unterstützt durch den Europäischen Forschungsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Bereich: Angstverhaltensforschung, Neurologie, Neurobiochemie, Neurobiologie
Originaltitel: NPY-mediated synaptic plasticity in the extended amygdala prioritizes feeding during starvation
Autoren: Stephan Dodt (1,2), Noah V. Widdershooven (2), Marie-Luise Dreisow (1,3), Lisa Weiher (1), Lukas Steuernagel (2), F. Thomas Wunderlich (2,3,4,5), Jens C. Brüning (2,3,4,5)*, Henning Fenselau (1,3,4)
Institute: (1) Synaptic Transmission in Energy Homeostasis, Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung, Gleueler Straße 50, 50931 Köln, (2) Neuronal Control of Metabolism, Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung, Köln, (3) Poliklinik für Endokrinologie, Diabetologie und Präventivmedizin, Universitätsklinikum Köln, Kerpener Straße 26, 50924 Köln, (4) Excellence Cluster on Cellular Stress Responses in Aging Associated Diseases (CECAD), Universität zu Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 26, 50931 Köln, (5) Zentrum für Molekulare Medizin Köln (CMMC), Universität zu Köln, Köln
Zeitschrift: Nature Communications 2024; 15: 5439
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5813
Dokument 4
Titel: Einfluss der ischämischen Fernkonditionierung und des Stickstoffmonoxids auf die Angiogenese und Mikrozirkulation in einem Modell für MäuseohrverbrennungenHintergrund: Es wird untersucht, wie sich das wiederholte Abschnüren eines Beins bei Mäusen auf die Heilung einer tiefen Brandwunde am Ohr auswirkt.
Tiere: 48 Mäuse
Jahr: 2024
Versuchsbeschreibung: Der Versuch wird von der zuständigen regionalen Behörde – vermutlich dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, Nordrhein-Westfalen - unter der Nummer 4-02.04.2015.A200 genehmigt. Es werden 48 männliche Nacktmäuse eingesetzt, die aus der Versuchstierzucht Charles River (Sulzfeld) stammen. Sie sind bei Beginn des Versuchs höchstens vier Wochen alt.
Die Mäuse werden mit einem gasförmigen Narkosegas narkotisiert. Ihr rechtes Ohr wird flach auf einer Acrylplatte ausgebreitet und mit Fäden fixiert. Den Mäusen werden Farbstoffe in die Schwanzvene gespritzt und ihr Ohr wird mit einem bildgebenden Verfahren untersucht. Den Tieren wird ein Schmerzmittel unter die Haut des Ohres gespritzt. Mit einem Heißluft-Lötgerät, dessen Spitze 1 mm oberhalb des Ohrs gehalten wird, wird ein 117 °C heißer Luftstrom für eine Sekunde auf das Ohr gerichtet. Dadurch entsteht eine Verbrennung, die tief in die Haut reicht. Das verbrannte Ohr wird erneut mit dem bildgebenden Verfahren untersucht.
Anschließend werden die Mäuse in vier Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe dient als Kontrollgruppe und erhält keine weitere Behandlung. Bei den anderen drei Gruppen wird in erneuter Narkose am linken Oberschenkel der Maus ein Silikonband für fünf Minuten so festgezogen, dass kein Blut mehr hindurchfließt und im Bein kein Puls mehr vorhanden ist. Danach wird das Band für zehn Minuten gelockert, sodass das Blut wieder zirkulieren kann. Dieser Zyklus wird dreimal wiederholt und an fünf aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt.
Zusätzlich erhalten die Mäuse dieser drei Gruppen unterschiedliche Wirkstoffe oder eine Kochsalzlösung unter die Haut gespritzt. An den Tagen 3, 7 und 12 nach der Verbrennung wird das verbrannte Ohr der Mäuse wieder mit dem bildgebenden Verfahren untersucht.
7 Mäuse erreichen das geplante Ende der Versuche nicht und sterben während oder unmittelbar nachdem ihr Bein mit dem Silikonbandband abgebunden wird. Als Todesursache wird Gewichtsverlust durch verringerte Nahrungsaufnahme genannt.
Nach 12 Tagen werden die überlebenden Mäuse auf nicht genannte Art getötet.
Die Arbeiten wurden durch die Heinrich und Alma Vogelsang Stiftung (Bochum) gefördert.
Bereich: Wundheilung
Originaltitel: Influence of remote ischemic conditioning and nitrogen monoxide on angiogenesis and microcirculation in a mouse ear burn model
Autoren: Maxi von Glinski (1)*, Maria Voigt (1), Alexander Sogorski (1), Christoph Wallner (1), Mehran Dadras (1), Bjoern Behr (1), Marcus Lehnhardt (1), Ole Goertz (1,2)
Institute: (1) Plastische Chirurgie und Handchirurgie, Schwerbrandverletztenzentrum, Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil, Ruhr-Universität Bochum, Bürkle-de-la-Camp Platz 1, 44789 Bochum, (2) Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie, Martin-Luther-Krankenhaus, Berlin
Zeitschrift: Journal of Surgical Research 2024; 293: 347-356
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5812
Dokument 5
Titel: Entwicklung eines Rattenmodells für bipolare StörungHintergrund: Die Veröffentlichung beschreibt eine von den Autoren entwickelte Methode zum Hervorrufen von Symptomen einer bipolaren Störung bei Ratten. Die Autoren beschreiben dies als Protokoll, damit auch andere Forscher die Versuche durchführen können.
Tiere: Ratten (Anzahl unbekannt)
Jahr: 2025
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, Nordrhein-Westfalen genehmigt. Es werden männliche Ratten der Rasse Sprague Dawley eingesetzt. Bei der Haltung wird bei Nacht das Licht eingeschaltet und bei Tag nur ein schwaches Rotlicht verwendet. An diese Umkehr des Tagesablaufs werden die Ratten eine Woche lang gewöhnt.
Den Ratten werden Schmerzmittel verabreicht, eines oral, ein anderes unter die Haut gespritzt. Sie werden in einen Behälter gesetzt, der mit einem gasförmigen Narkosemittel gefüllt wird, dann wird weiteres Narkosemittel über eine Maske verabreicht. Der Schädel der Ratten wird in einen sogenannten stereotaktischen Rahmen eingespannt. Die Kopfhaut wird auf ca. 1,5 cm Länge aufgeschnitten und mit Klammern zurückgezogen. Mit einem zahnmedizinischen Bohrer wird ein ca. 1 mm großes Loch in den Schädel gebohrt. Durch das Loch wird mit einer Nadel ein gentechnisch veränderter Virus in eine bestimmte Region des Gehirns injiziert. Dies bewirkt, dass sich das Belohnungssystem des Gehirns durch Gabe eines Wirkstoffs gezielt verändern lässt. Die Injektion wird in beiden Gehirnhälften durchgeführt.
Um Symptome einer Manie auszulösen, wird den Ratten ein Wirkstoff in das Trinkwasser gemischt. Sieben Tage nach Beginn dieser Behandlung werden Verhaltenstests durchgeführt. Um depressive Symptome hervorzurufen, wird der Wirkstoff abgesetzt. Nach etwa 4 Tagen werden erneut Verhaltenstests durchgeführt. Es sollen dabei immer mehrere Verhaltenstests miteinander kombiniert werden und die Ratten sollen immer von derselben Person gehandhabt werden, da unterschiedliche Personen die Resultate verändern können. Von den Autoren werden verschiedene Verhaltenstests vorgeschlagen, die sie auch selbst angewendet haben:
- Zwei-Flaschen-Test: Die Ratte bekommt zwei Flaschen: eine mit normalem Wasser, eine mit Zuckerlösung. Vermehrtes Trinken des Zuckerwassers wird als manisches Verhalten interpretiert; trinkt das Tier weniger Zuckerwasser, gilt es als depressiv.
- Sexualverhalten: Die Ratte wird mit einem empfängnisbereiten Weibchen in eine Testumgebung gesetzt. Eine erhöhte Anzahl an Paarungsversuchen wird als manisches Verhalten und ein reduziertes Sexualverhalten als depressiv interpretiert.
- Cocain-Selbstverabreichung: Die Ratten lernen, sich durch eine bestimmte Handlung selbst Kokain zu verabreichen. Tun sie das häufiger, gelten sie als „manisch“.
- Glücksspiel-Aufgabe: Die Ratten stehen vor verschiedenen Wahlmöglichkeiten, die mit unterschiedlich hohem Risiko und Belohnung verbunden sind. Wählen sie riskantere Optionen, gilt das als Zeichen für eine Manie.
- Erhöhtes Plus-Labyrinth: Eine Ratte wird auf ein kreuzförmiges Podest gesetzt, das zwei geschlossene und zwei offene Arme hat. Verbringt sie mehr Zeit auf den offenen Armen anstatt auf den geschützteren geschlossenen Armen, gilt dies als manisch.
- Hilflosigkeitstest: Der Ratte werden Stromschläge verabreicht. Versucht die Ratte nicht, diesen zu entkommen, gilt das als depressiv.
- Murmelvergrabungstest: Auf dem Boden des Käfigs werden Murmeln verteilt. Wenn die Ratten die Murmeln im Einstreu vergraben, gilt dies als Zeichen von Angst.
Die Autoren geben an, dass man bei den Tieren auch mehrfach hintereinander zwischen manischen und depressiven Symptomen wechseln kann.
Am Ende der Versuche werden die Ratten getötet und ihr Gehirn wird untersucht, um zu überprüfen, ob bei der Virusinjektion die richtige Stelle im Gehirn getroffen wurde.
Die Arbeiten wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum gefördert.
Bereich: Versuchstierkunde, Psychiatrie
Originaltitel: Developing a rat model for bipolar disorder
Autoren: Julia Aslan (1), Patrick R. Reinhardt (1,2), Jennifer Koch (1), Kai-Christian Sonntag (3), Nadja Freund (1)*
Institute: (1) Abteilung Experimentelle und Molekulare Psychiatrie, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin, LWL-Universitätsklinikum Bochum der Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum, (2) International Graduate School of Neuroscience, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, (3) Department of Psychiatry, Basic Neuroscience Division, McLean Hospital, Harvard Medical School, Belmont, USA
Zeitschrift: Journal of Visualized Experiments 2025; (219): e68307
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5811
Dokument 6
Titel: Wolfram-Silikon-Implantate als effektiver Strahlenschutz bei der okulären Brachytherapie: dosimetrische Eigenschaften und In-vivo-Tierstudie zur BiokompatibilitätHintergrund: Es wird für Kaninchen überprüft, ob das Einsetzen von Wolfram-Silikon-Implantaten in die Augen zu Entzündungen oder Schäden führt. Die Implantate sollen als Strahlenschutz bei der Behandlung von Augentumoren eingesetzt werden.
Tiere: 7 Kaninchen (Weiße Neuseeländer-Kaninchen)
Jahr: 2024
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen unter der Nummer 81-02.04.2020A135 genehmigt. Es werden 7 weibliche Kaninchen eingesetzt, die aus der Versuchstierzucht Charles River (Romans, Frankreich) stammen. Die Kaninchen werden am Zentralen Tierlaboratorium des Universitätsklinikums Essen einzeln gehalten.
Die Kaninchen werden durch Injektion in die Oberschenkelmuskulatur narkotisiert. Die Pupillen der Tiere werden mit speziellen Augentropfen weit gestellt. Anschließend werden die Kaninchen in vier Gruppen eingeteilt.
In der ersten Gruppe wird den Kaninchen im linken Auge das Augeninnere (genauer gesagt der Glaskörper) entfernt und durch medizinisches Silikonöl ersetzt. In der zweiten Gruppe wird die Bindehaut aufgeschnitten, also die Schleimhaut um das Auge, dann wird ein Implantat aus Wolfram und Silikon mit Fäden auf die Lederhaut (äußere Schicht des Auges) platziert und die Bindehaut wieder zugenäht.
Die dritte Gruppe wird wie die erste behandelt, es wird aber eine Flüssigkeit, die Wolframpulver mit Silikonöl enthält, in das Auge eingespritzt.
In der vierten Gruppe wird beides kombiniert: eine Injektion der Wolfram-Silikon-Flüssigkeit ins Auge und zusätzlich ein festes Implantat auf die Lederhaut des Auges.
Nach diesen Eingriffen bleiben die Kaninchen drei Monate unter Beobachtung. In dieser Zeit wird überprüft, ob das eingesetzte Material Reizungen oder Entzündungen verursacht.
Nach den drei Monaten werden die behandelten Augen entfernt. Dazu werden die Kaninchen vermutlich unter Narkose auf nicht genannte Art getötet. Das entnommene Gewebe wird unter dem Mikroskop untersucht. Einige der Augen weisen Entzündungen, Linsentrübungen und Narben auf.
Die Arbeiten wurden durch die Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung und die Willy Robert Pitzer Stiftung gefördert.
Bereich: Augenheilkunde, Nuklearmedizin
Originaltitel: Wolfram-silicone implants as effective radiation shielding for ocular brachytherapy: dosimetric features and in vivo animal study on biocompatibility
Autoren: Ekaterina A Sokolenko (1)*, Dirk Flühs (2), Fotis Lalos (3), Peter Meyer (4), Miltiadis Fiorentzis (5), Migle Lindziute (1), Justine Gemmecke (6), Utta Berchner-Pfannschmidt (5), Ulrike Hendgen-Cotta (7), Nikolaos E Bechrakis (5), Theodora Tsimpaki (4), Marko Dubicanac (8), Andreas Wißmann (8), Gero Hilken (8)
Institute: (1) Klinik für Augenheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Straße1, 30625 Hannover, (2) Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsmedizin Essen, Universität Duisburg-Essen, Essen, (3) MVZ Augenzentrum Altenessen GmbH, Essen, (4) Augenklinik, Universitätsspital Basel, Basel, (5) Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Essen, (6) Fakultät Physik, Technische Universität Dortmund, Dortmund, (7) Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum Essen, Klinik für Kardiologie und Angiologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, (8) Zentrales Tierlaboratorium Essen, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Hufelandstraße 55, 45147 Essen
Zeitschrift: Canadian Journal of Ophthalmology 2024; 59(5), e515-e524
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5810
Dokument 7
Titel: Die Blockade des neonatalen Fc-Rezeptors (FcRn) ist in einem Tiermodell der chronischen Neuritis nicht vorteilhaftHintergrund: Es wird untersucht, ob eine Behandlung mit bestimmten Antikörpern bei Mäusen mit einer autoimmunen Nervenentzündung die Symptome der Tiere beeinflusst.
Tiere: 50 Mäuse
Jahr: 2025
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen unter der Nummer 84–02.04.2015.A108 genehmigt. Es werden weibliche Mäuse verwendet, die genetisch so verändert sind, dass sie im Alter von etwa einem Jahr eine autoimmun vermittelte Nervenentzündung (Neuritis) entwickeln. Symptome der Entzündung sind Störungen der Bewegungskoordination und Muskelschwäche.
Im Alter von 12 bis 18 Monaten werden die Mäuse in drei Gruppen aufgeteilt. Den Mäusen wird über einen Zeitraum von 7 Wochen zweimal pro Woche eine Antikörper-haltige Lösung in die Bauchhöhle injiziert. Eine Gruppe bekommt einen Antikörper, der einen bestimmten Rezeptor im Körper blockieren soll. Die zweite Gruppe bekommt zur Kontrolle einen wirkungslosen Antikörper, und die dritte Gruppe erhält ein Medikament, das bereits beim Menschen eingesetzt wird.
Während der siebenwöchigen Behandlung wird zweimal pro Woche der Gesundheitszustand der Mäuse geprüft. Dafür werden die Mäuse am Schwanz hochgehoben und es wird geprüft, wie die Tiere in dieser Position ihre Beine halten. Auch wird der Gang der Mäuse analysiert.
Einmal pro Woche wird die Kraft der Hinterbeine gemessen. Dafür wird die Maus im Nackenfell hochgehoben und so gehalten, dass sie mit den Hinterpfoten eine Metallstange greifen kann. Dann wird die Maus von der Stange weggezogen, bis sie loslässt. Dabei misst ein Gerät, wie viel Kraft die Maus dabei aufwendet. Der Test wird jeweils dreimal wiederholt.
Während der Behandlung nehmen die Symptome der Mäuse weiter zu. Am Ende der sieben Wochen wird den Mäusen Blut abgenommen. Unter Narkose wird ihnen eine konservierende Flüssigkeit in das Herz gepumpt, wobei die Tiere sterben.
Teile der Arbeiten wurden durch das Pharmaunternehmen UCB Pharma gefördert.
Bereich: Pharmakologie, Neuropathologie, Neuroimmunologie
Originaltitel: Targeting the neonatal Fc receptor (FcRn) is not beneficial in an animal model of chronic neuritis
Autoren: Anne K. Mausberg (1)*, Fabian Szepanowski (1), Bianca Eggert (1), Kai C. Liebig (1), Christoph Kleinschnitz (1), Bernd C. Kieseier (2), Mark Stettner (1)
Institute: (1) Klinik für Neurologie und Center for Translational Neuro- and Behavioral Sciences (C-TNBS), Universitätsmedizin Essen, Universität Duisburg-Essen, Hufelandstraße 55, 45147 Essen, (2) Neurologische Klinik, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Düsseldorf
Zeitschrift: Immunologic Research 2025; 73(1): 12
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5809
Dokument 8
Titel: Sauerstoffarme und kohlendioxidreiche Höhlenbedingungen führen bei Ansell-Graumullen (Fukomys anselli) zu einer Herunterregulierung von freiem Trijodthyronin und HämatokritHintergrund: Die Auswirkungen von sauerstoffarmen und kohlendioxidreichen Bedingungen werden für Graumulle untersucht.
Tiere: 12 Sonstige (Ansell-Graumulle)
Jahr: 2024
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) unter der Nummer 81-02.04.2019.A455 genehmigt. In den Versuchen werden Graumulle eingesetzt, die an der Gruppe Allgemeine Zoologie der Universität Duisburg-Essen gehalten werden. Die Haltung erfolgt in Terrarien mit Sägespänen.
In dem eigentlichen Versuch werden 12 Graumulle narkotisiert und ihnen wird Blut aus einer Vene an der Vorderpfote abgenommen. Dann werden sie in Gruppen von jeweils 3 bis 5 Tieren in Terrarien (80 × 35 × 40 cm) gesetzt, die Erde enthalten. Dies kommt dem natürlichen Lebensraum der Tiere im Vergleich zur vorherigen Haltung näher und die Mulle beginnen sofort, unterirdische Tunnel in die Erde zu graben.
Zwischen Erdoberfläche und der Terrarienabdeckung wird ein 5-8 cm hoher Spalt gelassen. Die Terrariendeckel sind mit Lüftungslöchern versehen, deren Anzahl so reguliert wird, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft im Terrarium auf unter 15% abnimmt (normal sind 21%). Dieser Prozess dauert 4 bis 7 Tage. Dann leben die Mulle 7 Tage lang unter den sauerstoffarmen und kohlendioxidreichen Bedingungen. Es wird beobachtet, wie viel Zeit die Tiere in ihren Tunneln und wieviel Zeit sie oberhalb der Erdoberfläche verbringen. Nach dem 7-tägigen Versuch werden die Tiere erneut in Narkose versetzt und ihnen wird Blut abgenommen.
Das weitere Schicksal der Graumulle wird nicht erwähnt. Vermutlich kehren sie in die „normale“ Haltung zurück und werden in weiteren Versuchen eingesetzt.
Die Arbeiten wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen gefördert.
Bereich: Tierphysiologie
Originaltitel: Hypoxic and hypercapnic burrow conditions lead to downregulation of free triiodothyronine and hematocrit in Ansell’s mole rats (Fukomys anselli)
Autoren: Yoshiyuki Henning (1)*, Kamilla Adam (2), Patricia Gerhardt (1), Sabine Begall (2)
Institute: (1) Institut für Physiologie, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Hufelandstr. 55, 45147 Essen, (2)* Gruppe Allgemeine Zoologie, Fakultät für Biologie, Universität Duisburg-Essen, Universitätsstr. 5, 45117 Essen
Zeitschrift: Journal of Comparative Physiology B 2024; 194(1): 33-40
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5808
Dokument 9
Titel: Die genetischen und in der Komplexität des Lebensraums begründeten Einflüsse auf die Unvorhersehbarkeit des Fluchtverhaltens einer GrashüpferartHintergrund: Es wird untersucht, wie sich genetische Veranlagung und Umweltbedingungen auf das Fluchtverhalten von Grashüpfern auswirken.
Tiere: 1926 Wirbellose (mindestens 1926 Grashüpfer)
Jahr: 2025
Versuchsbeschreibung: Versuche mit Insekten erfordern keine Genehmigung. Im Juni/Juli 2018 werden in der Umgebung von Jena 511 Steppengrashüpfer (Chorthippus dorsatus) gefangen. Es handelt sich dabei um Jungtiere, die sich noch nicht fortgepflanzt haben. Die Tiere werden nach Geschlechtern getrennt und in Gruppen von bis zu 90 Tieren gehalten, bis sie erwachsen sind.
Dann werden 51 Männchen mit jeweils 3 bis 7 Weibchen verpaart (insgesamt 249 Weibchen). Die Paare kommen dazu einzeln in kleinere Käfige (22 x 16 x 16 cm). Die von den Weibchen angelegten Eier werden eingesammelt und überwintern in einem Kühlschrank. Im Frühling werden die Eier aus dem Kühlschrank geholt. Die daraus geschlüpften 1.415 Grashüpfer wachsen in zwei verschiedenen Käfigarten auf: Die eine Hälfte lebt in weißen Käfigen ohne besondere Einrichtung, die andere Hälfte in Käfigen mit farbigem Untergrund, die etwas Eierkarton und ein Stück Pfeifenreiniger zum Klettern und Verstecken enthalten. 11 Tiere sterben vor ihrer letzten Häutung.
Wenn die Tiere erwachsen sind, findet ein Verhaltenstest statt, in dem ein Teil der Grashüpfer eingesetzt wird (839 Individuen, etwa 3 aus jedem Käfig). Vor dem Test werden die Grashüpfer auf dem Rücken mit gelber Farbe markiert und über Nacht bei 8°C gekühlt. Dann werden jeweils zwei Grashüpfer gemeinsam in eine Testarena gesetzt. Diese ist mit einem farbigen Boden ausgestattet, der den von komplexen eingerichteten Käfigen ähnelt. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit wird jeder Grashüpfer zehnmal von einem langsam fahrenden Gerät („Jäger“) verfolgt. Dieses soll einen angreifenden Feind nachahmen. Wenn der Grashüpfer flieht, zeichnet eine Software auf, wann und wohin er springt. Nach jedem Sprung gibt es zwei Minuten Pause, dann folgt der nächste Versuch. Das weitere Schicksal der Grashüpfer wird nicht erwähnt.
Die Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Bereich: Verhaltensforschung
Originaltitel: Genetic and habitat complexity effects on unpredictability in escape behaviour of a grasshopper species
Autoren: Gabe Winter, Holger Schielzeth
Institute: Populationsökologie, Institut für Ökologie und Evolution, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Dornburger Straße 159, 07743 Jena
Zeitschrift: Journal of Evolutionary Biology 2025; 38(5):618:629
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5807
Dokument 10
Titel: Beeinträchtigte Biogenese basischer Proteine beeinflusst mehrere Kennzeichen des alternden GehirnsHintergrund: Killifische werden wegen ihrer kurzen Lebensdauer als sogenannte Tiermodelle für Alterungsprozesse verwendet. Hier wird für den Killifisch untersucht, wie das Gehirn beim Altern auf der Ebene seiner Bausteine (Proteine), deren Herstellung (Translation) und „Baupläne“ (mRNA) verändert wird.
Tiere: Fische (Anzahl unbekannt)(sehr viele Killifische)
Jahr: 2024
Versuchsbeschreibung: Die Versuche werden von der zuständigen Behörde im Freistaat Thüringen (Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) unter der Nummer 22-2684-04-FLI-19-010 genehmigt.
Es werden Killifische (Nothobranchius furzeri) eingesetzt, die in der Fischhaltung des Fritz-Lipmann-Institut gezüchtet und gehalten werden. Die Haltung erfolgt unter der Lizenznummer J-003798. Die Studien umfassen Fische unterschiedlichen Alters: Jung (5 Wochen nach dem Schlüpfen), Erwachsen (12 Wochen alt) und Alt (39 Wochen alt).
Fische aller drei Altersgruppen werden auf nicht genannte getötet und ihre Gehirne entnommen und untersucht.
Erwachsene Fische werden narkotisiert, indem sie in eine Lösung der Chemikalie MS-222 gegeben werden. Dann wird ihnen ein Wirkstoff in die Bauchhöhle injiziert, der den Abbau von beschädigten oder nicht mehr benötigten Eiweißen blockiert. Einem Teil der Fische wird stattdessen eine wirkstofffreie Lösung gespritzt. Die Injektion erfolgt über einen Zeitraum von 4 Wochen insgesamt viermal.
Dann werden die Fische auf nicht genannte Art getötet und ihre Gehirne werden entnommen und untersucht.
Die Arbeiten wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Else Kröner Fresenius Stiftung, die Fritz Thyssen Stiftung, die Chan Zuckerberg Initiative (USA), die Europäische Union, die NCL-Stiftung, die National Institutes of Health (USA), und das italienische Ministerium für Universitäten und Forschung gefördert.
Bereich: Altersforschung, Neurologie
Originaltitel: Impaired biogenesis of basic proteins impacts multiple hallmarks of the aging brain
Autoren: Domenico Di Fraia (1), Antonio Marino (1), Jae Ho Lee (2), Erika Kelmer Sacramento (1), Mario Baumgart (1), Sara Bagnoli (3), Pedro Tomaz da Silva (4,5), Amit Kumar Sahu (1), Giacomo Siano (3), Max Tiessen (1), Eva Terzibasi-Tozzini (3), Julien Gagneur (4,6,7), Judith Frydman (2)*, Alessandro Cellerino (1,3)*, Alessandro Ori (1)*
Institute: (1) Leibniz-Institut für Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut, Beutenbergstraße 11, 07745 Jena, (2) Department of Biology, Stanford University, Stanford, USA, (3) BIO@SNS, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien, (4) School of Computation, Information and Technology, Technische Universität München, Garching, (5) Munich Center for Machine Learning, Technische Universität München, München, (6) Computational Health Center, Helmholtz Zentrum München, Neuherberg, (7) Institut für Humangenetik, TUM Klinikum, Technische Universität München, München
Zeitschrift: bioRxiv 2024; doi: 10.1101/2023.07.20.549210
Land: Deutschland
Art der Veröffentlichung: Fachzeitschrift
Dokumenten-ID: 5806
Weitere Resultate finden Sie auf den folgenden Seiten:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 >>
Im Sinne des Verstorbenen: Kondolenzspende
Im Trauerfall kommt oft der Wunsch auf, etwas zu tun, das im Sinne des Verstorbenen gewesen wäre und über dessen Tod hinaus wirkt. Hier bietet sich die Kondolenzspende anstelle von Kränzen und Blumen an.
Da wir Ärzte gegen Tierversuche uns gegen Leid und für eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin und Wissenschaft einsetzen, setzen Sie durch eine Kondolenzspende an uns gleichsam ein Zeichen für das Leben.
Wenn wir trauern, steht uns selten der Sinn nach Regelung von Formalitäten. Teilen Sie daher dem Bestatter baldmöglichst mit, dass Sie eine Kondolenzspende wünschen, und er wird dann alle erforderlichen Schritte einleiten. Wichtig ist, neben der Kontoverbindung ein Kennwort für den Verwendungszweck anzugeben.
Lebenswichtig: Ihr Testament für Mensch & Tier
Auch wenn uns der Gedanke schmerzt, dass wir die Abschaffung aller Tierversuche vielleicht selbst nicht mehr miterleben werden, möchten wir anderen die Weiterführung unserer Arbeit zur Verwirklichung dieses Zieles ermöglichen, denn wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin. Mit einem Testament, in welchem Sie die Ärzte gegen Tierversuche berücksichtigen, können Sie über Ihren Tod hinaus wesentlich dazu beitragen, dass wir unser Engagement für die namenlosen Tiere in den Labors und für eine Welt mit humanrelevanter, fortschrittlicher, tierversuchsfreier Forschung intensiv fortführen können. Damit Ihr letzter Wille auch tatsächlich in Ihrem Sinne umgesetzt wird, ist es wichtig, einige rechtliche Regelungen zu kennen und zu wissen, welche Formalitäten beachtet werden müssen.
Daher haben wir für Sie eine Broschüre erstellt: Als PDF >> herunterladen oder bestellen Sie sie als kostenfreie Druckausgabe in unserer Geschäftsstelle.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben.

Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Testament und Vererben
Geschäftsführer Finanzen Claus Kronaus
Tel: 02204 99902-10
Mobil: 0173-2534903
E-Mail: kronaus@aerzte-gegen-tierversuche.de
Viele Informationen, inklusive Fachanwälte hält auch diese Seite für Sie bereit: www.erbrechtsinfo.com
Spenden zu persönlichen Anlässen
Es gibt so viele Möglichkeiten, zu helfen. Z. B. anlässlich eines Geburtstags oder Jubiläums. Vielleicht kennen Sie das? Sich selbst „wunschlos glücklich“ zu fühlen und anderen Unterstützung zukommen lassen zu wollen. Ein Fest mit dem Motto „Spende als Geschenk“ zu begehen ist auf jeden Fall eine eindrucksvolle, gute Tat, die unserem Verein viel gibt und Vielen Freude macht.
Empfehlenswert ist, bereits bei der Einladung darauf hinzuweisen, dass Sie sich Spenden statt Geschenke wünschen. Wenn Sie um Bargeld bitten, stellen Sie besser kein „Sparschwein“ auf, da Sie die Gaben dann nicht zuordnen können. Als ideal hat sich erwiesen, wenn der Jubilar, das Brautpaar o.a. das geschenkte Bargeld als Gesamtsumme an uns überweist. Auch Überweisungen der Gäste - mit einem durch Sie festgelegten Verwendungszweck - auf unser Konto sind möglich, jedoch weniger vorteilhaft (u.a. dürfen wir datenschutzrechtlich nicht mitteilen, wer welchen Betrag überwiesen hat).
Wenn Sie uns rechtzeitig im Voraus verständigen, schicken wir Ihnen selbstverständlich auch gern kostenlos Infomaterial zum Auslegen.
Und das Wichtigste: Es kommt nicht auf die Spendenhöhe an, sondern dass es Ihnen ein Herzenswunsch ist!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin
für alle Fragen zu Anlassspenden
Stephanie Elsner
Tel: 02204 99902-17
E-Mail: elsner@aerzte-gegen-tierversuche.de
So können Sie helfen, Tierversuche zu stoppen
Infos verbreiten, Menschen überzeugen
Infomaterial verbreiten
Informieren Sie sich, damit Sie argumentieren können. Und: Geben Sie Flyer und Broschüren im Bekanntenkreis weiter. Bitten Sie auch Tierärzte und Ärzte, in den Wartezimmern Infomaterial auslegen zu dürfen. Unser Sortiment finden Sie im Online-Shop - empfehlenswert zur allgemeinen Info: die Broschüre „Hinschauen“.
Ob T-Shirt oder Tasse - viele Produkte bieten wir auch an über den Spreadshop >>
Verlinken & Teilen über Social Media
Vernetzen Sie uns auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Wenn Sie eine Homepage haben, verlinken Sie uns.
Oder starten Sie unter Ihren Facebook-Freunden eine Spendenaktion, z.B. zum Geburtstag oder Jubiläum oder einfach so.
Unterschriften sammeln
Dass viele Bürger unsere Forderungen unterstützen, ist wichtig für Entscheidungsträger. Klicken Sie mit bei unseren Online-Petitionen und sammeln Sie Unterschriftenlisten gegen Tierversuche. Informieren Sie Ihre Lokalzeitung über Ihre Sammelaktion.
Zeigen Sie Ihre Meinung
Benutzen Sie unsere Bio-Fair-Trade-Baumwolltaschen, Kugelschreiber, Anstecker, Aufkleber etc. - Sie finden sie in unserem Online-Shop.
Ob T-Shirt, Hoddie oder Tasse - viele Produkte bieten wir auch an über den Spreadshop >>
Schreiben Sie...
…kurze, sachliche Leser-, Hörer- bzw. Zuschauerbriefe. Bitten Sie auch Presse, Rundfunk und Fernsehen, öfter kritisch über das Thema zu berichten. Fordern Sie Politiker und die Bundesregierung auf (z. B. über das für Tierschutz zuständige Landwirtschaftsministerium), ein Ausstiegskonzept aus Tierversuchen zu schaffen, tierversuchsfreie Forschung stärker zu fördern und die behördliche Anerkennung solcher Verfahren zu beschleunigen. Schreiben Sie auch Firmen, Unis etc., die Tierversuche durchführen oder in Auftrag geben, sich für den Forschungswandel einzubringen.
Tierschutz in der Schule
Thematisieren Sie als Lehrer Tierversuche in Ihrem Unterricht. Arbeitsmaterial zum Download und regionale Tierschutzlehrer: www.tierschutz-in-der-schule.de.
Für Kids im Grundschulalter bieten wir an: www.harry-hilft-tieren.de
Bitten Sie als Eltern oder Schüler, dieses Thema im Unterricht zu behandeln.
Vor Ort aktiv werden
Ehrenamtliche Arbeit
Ob einzeln oder in einer Arbeitsgruppe vor Ort, ob im Kurzzeit-Aktivismus zum „Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche“ (April) oder im Online-Aktivismus von Zuhause aus, mit uns können sich alle Menschen gegen Tierversuche und für eine sinnvolle Forschung einsetzen. Infos gibt es hier >>.
Demos und Aktionen unterstützen
Nehmen Sie an Demonstrationen oder anderen Veranstaltungen gegen Tierversuche teil. Termine finden Sie hier.
Ausstellung organisieren
Unsere Ausstellungstafeln informieren sachlich fundiert über verschiedene Aspekte des Tierversuchs und zur tierversuchsfreien Forschung. Die Ausstellung kann geliehen oder gekauft werden.
Finanziell helfen - mit und ohne Geld
Spenden und Mitgliedschaften stärken die Basis
Unterstützen Sie unsere Arbeit für die Tiere durch eine Spende und werden Sie Mitglied oder Fördermitglied. Je größer unsere Vereinigung wird, desto stärker wird die Stimme, mit der wir für die Tiere sprechen, wahrgenommen.
Ein wertvoller Klick vor Ihrem Online-Einkauf
Ob bei der Bahn, Ebay oder Otto, wenn Sie Ihre ganz normalen Online-Einkäufe in rund 2.000 Shops über Gooding tätigen, erhalten wir eine Provision!
Der Einkauf kostet Sie keinen Cent extra! Und wer die Browser Firefox oder Crome nutzt, kann sich auch gleich die Gooding/Toolbar installieren, um keinen Einkauf für den guten Zweck zu vergessen.
Charity-Shopping für ÄgT bieten auch WeCanHelp sowie Bildungsspender.
Bei PayPal-Zahlungen ÄgT mit 1 Euro unterstützen
PayPal bietet die Möglichkeit, am Ende eines Bezahlvorgangs 1 € an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. ÄgT gehört dazu - und so können Sie uns unterstützen: Klicken Sie einfach auf der PayPal-Website auf das ÄgT-Logo und legen Sie uns im sich öffnenden Fenster als bevorzugte Organisation fest. Nun müssen Sie nur noch während des Bezahlvorgangs Ihres Kaufs das Häkchen für die 1-Euro-Spende setzen. Ihre Spende kommt zu 100 % bei uns an, da PayPal sämtliche Transaktionsgebühren übernimmt. Danke für Ihre Unterstützung!
PayPal-Website >>
Anlass-Spenden
Ob Geburtstag, Firmenjubiläum oder im Trauerfall im Sinne des Verstorbenen Gutes tun - es gibt viele Anlässe für eine Spendenaktion. Sie können hier wertvolle Beiträge leisten.
Lebensweise ändern
Kosmetik ohne Tierversuche
Verzichten Sie auf Kosmetikartikel, deren Inhaltsstoffe im Tierversuch getestet wurden. Infos zu den verschiedenen Siegeln, finden Sie hier: www.tierversuchsfrei-shoppen.de.
Gesunde Lebensführung
Die beste Medizin, um einem Großteil der Zivilisationskrankheiten vorzubeugen, ist eine gesunde, vegetarische oder besser vegane Ernährung, verbunden mit einem bewussten Lebensstil (Verzicht auf Suchtmittel, wenig Stress, Bewegung an frischer Luft usw.).
Nur wenn jeder sich selbst bewegt, kann etwas bewegt werden!
Dies sind einige Vorschläge, je nach Ihren persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten aktiv zur Abschaffung der Tierversuche beizutragen.
Bitte lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie das Gefühl haben, mit Ihren Bemühungen keinen Erfolg zu haben (ein Bekannter nicht interessiert ist, ein Leserbrief nicht veröffentlicht wird, ein Politiker nicht reagiert usw.). Wichtig ist, dass Ihre Umgebung überhaupt auf die Problematik aufmerksam gemacht wird, Firmen Ihre Macht als Verbraucher spüren und/oder der Gesetzgeber durch Sie als wählender Bürger zum Handeln aufgefordert wird. Auch vermeintlich kleine Erfolge können Tierleben retten.
Haben Sie den Mut, etwas, was Sie selbst für richtig halten, auch gegen den Trend zu tun. Besonders bei unserem Anliegen ist es wichtig, nicht aufzugeben. Nur durch Beharrlichkeit werden wir letztlich unser Ziel erreichen – die Abschaffung aller Tierversuche.