Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!
17. Januar 2013
Eine am 11. Januar 2013 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift International Journal of Medical Sciences veröffentlichte Studie bestätigt erneut, dass Tierversuchsergebnisse nicht auf den Menschen übertragbar sind. Die beiden Wissenschaftler von der Organisation Americans For Medical Advancement, Kalifornien, kommen nach ihrer Analyse zu dem Schluss, dass selbst bei einer verbesserten Standardisierung von »Tiermodellen« diese kein geeignetes Mittel sind, um Reaktionen des Menschen auf Medikamente und andere Stoffe vorherzusagen.
Einzelne wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften können Fehlern oder Befangenheit der Forscher unterliegen. Systematische Übersichtsartikel (Reviews) sind derzeit die bevorzugte Methode, um wissenschaftliche Arbeiten zu beurteilen. Dabei werden eine große Anzahl Einzelstudien, die bestimmte Kriterien erfüllen, zusammengefasst, um so zu einer möglichst aussagekräftigen Schlussfolgerung zu gelangen.
Die Autoren dieses Artikels stehen auf dem Standpunkt, dass systematische Reviews zur Beurteilung von Tierversuchsstudien nicht geeignet sind, weil Tierversuche in sich schon eine ungeeignete Methode sind, um Reaktionen des Menschen vorherzusagen.
Das Ziel, Ergebnisse aus Tierversuchen auf den Menschen übertragen zu wollen, ist eine der wichtigsten Rechtfertigungen zur Durchführung von Tierversuchen. Die tierexperimentelle Forschung geht davon aus, dass durch Verbesserung der Standardisierung der Versuche (z.B. bezüglich Haltungsbedingungen, Zuchtlinie usw.) auch die Übertragbarkeit verbessert werden könne.
Die Autoren führen eine Reihe von Beispielen an, die die ausgesprochen schlechte Übertragbarkeit von Tierversuchen in der Vergangenheit belegen. So waren bereits rund 100 Impfstoffe gegen HIV im »Tiermodell« wirksam, jedoch keiner davon beim Menschen. Selbst wenn morgen auf der Basis von Tierversuchen ein wirksamer Impfstoff gegen HIV gefunden werden würde, so wäre das »Tiermodell« dennoch gescheitert, da der Vorhersagewert bei etwa 0,01 liegen würde. Gleiches gilt für Rückenmarksverletzungen, bei denen 22 Wirkstoffe im Tierversuch einen therapeutischen Effekt zeigten, nicht aber beim Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus in führenden Fachjournalen erschienenen Studien tierexperimenteller Grundlagenforschung ein neues Medikament entsteht, liegt bei 0,004 Prozent.
Durchaus vermögen Tierversuche Nebenwirkungen von neuen Wirkstoffen aufzudecken, allerdings nicht die gleichen wie beim Menschen. So zitieren die Autoren eine Untersuchung, in der Ergebnisse aus Tierstudien zu sechs Medikamenten mit bekannten Humandaten verglichen wurden. Bei den Tieren traten 48 Nebenwirkungen auf, die nicht beim Menschen vorkamen. Dagegen traten 20 Nebenwirkungen beim Menschen auf, die beim Tier nicht entdeckt worden waren.
Die Autoren gehen den Ursachen dieser erheblichen Unterschieden nach und postulieren, dass die biologische Evolution zu äußerst komplexen Systemen geführt hat, bei denen das System weit mehr ist als die Summe seiner Teile. Wenn selbst eineiige Zwillinge auf Substanzen unterschiedlich reagieren können, wie kann man dann annehmen, Tiere seien als Stellvertreter für den Menschen geeignet?
Die heutige Medizin produziert Substanzen, die bei möglichst vielen Menschen wirken sollen. Dass dies aufgrund der großen Bandbreite der Bevölkerung viel zu oft nicht funktioniert, wird immer deutlicher. Die Autoren kommen zu dem Schluss kommen, dass die Zukunft in der personalisierten Medizin zu sehen ist, bei der Behandlungsmethoden individuell zugeschnitten werden, also das Gegenteil von standardisierten Tierversuchen.
Quelle
Greek, Rey, Andre Menache: Systematic Reviews of Animal Models: Methodology versus Epistemology. International Journal of Medical Sciences 2013: 10; 206-221
8. Oktober 2013
Ratten werden bis zur Erschöpfung zum Schwimmen gezwungen und Affenmüttern werden ihre Kinder weggenommen, um beispielsweise die menschliche Depression oder die Auswirkung sozialer Isolation und Entwöhnung zu ergründen. Ein 2012 in der medizinischen Fachzeitschrift Psychiatric Times erschienener Artikel beleuchtet die in der psychiatrischen Forschung durchgeführten Tierversuche und resümiert, dass diese nicht geeignet sind, um psychische Erkrankungen des Menschen zu erforschen.
Viele wesentliche Fortschritte in der psychiatrischen Forschung beruhen auf Zufallsentdeckung oder gezielter Patientenbeobachtung. So wurde 1957 Isoniazid, das erste Antidepressivum, zufällig entdeckt, da es im Rahmen der Tuberkulosetherapie zu Stimmungsverbesserungen der Patienten führte. Dennoch werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts sogenannte Tiermodelle konstruiert, die vorgeblich dazu dienen, psychische Erkrankungen des Menschen wie Angstzustände, Depression oder das Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-Syndrom zu erforschen.
Bislang gibt es nur wenige systematische Untersuchungen, die die am Tier erlangten Ergebnisse mit denen am Menschen vergleichen. Bei Betrachtung dieser kommt der Autor zu der Folgerung, dass das Tiermodell hinsichtlich der Vorhersage für den Menschen sehr schlecht abschneidet.
Der Autor betrachtet die standardmäßig in der tierexperimentellen Psychiatrie durchgeführten Tierversuche mit Blick auf den vorgeblichen Nutzen für den Menschen. Beim forcierten Schwimmtest nach Porsolt muss eine Ratte oder Maus bis zur Erschöpfung schwimmen, was der Erforschung menschlicher Depression dienen soll. Dieser Test wird jeweils mit und ohne Verabreichung eines potentiellen Medikamentes durchgeführt. Zahlreiche Medikamentengruppen wie unter anderem Stimulantien, Antiepileptika, Pentobarbital und Opiate hatten im Tierversuch eine positive Wirkung, beim Menschen jedoch nicht.
Hunde werden als „Modell" für Zwangserkrankungen des Menschen verwendet. Die Tiere leiden aufgrund einer Allergie an Hautentzündungen. Dies führt zu verstärktem Schlecken der Wunden, was als Zwangsstörung interpretiert wird. Während Zwangserkrankungen beim Menschen vielfältige Ursachen haben, liegt bei den Hunden eine Allergie zugrunde, weswegen dem Autor zufolge schon die Versuchskonzeption von Vornherein nutzlos ist.
In Versuchen zwischen 1957 und 1963 wurden Rhesusaffen-Babys von ihren Müttern getrennt und die Auswirkungen von teilweiser oder vollständiger sozialer Isolation beobachtet. Einige der Affen wurden bis zu 15 Jahre in Einzelhaft gehalten. Allerdings ist es nach Aussage des Autors nicht möglich, Gefühle der Wertlosigkeit, übermäßige Schuldgefühle, Unentschlossenheit und Todesgedanken durch Beobachtung bei Affen zu ermitteln.
Von Tierversuchbefürworten wird die Eignung von Tieren als „Modell" für den Menschen oft damit begründet, dass beispielsweise bei Maus und Mensch 97% der Gene übereinstimmen. Die Studie verweist daher auf den wissenschaftlichen Nachweis, dass die jeweils gleichen Gene zu vollkommen unterschiedlichen Merkmalesausprägungen führen können, da das Zusammenspiel der Gene entscheidend ist.
Der Artikel folgert, dass zur Diagnosestellung und Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen beim Menschen die Zukunft in einem integrativen Ansatz liegt, bei dem unter anderem nicht invasive Untersuchungstechniken, pharmakologische Untersuchungen wie Pharmako-Magnetoenzephalographie sowie klinische Beobachtung kombiniert werden. Zudem sei es dringend notwendig, insbesondere in der Psychiatrie und Psychologie die Empathie als wesentliche Grundlage und als Gegenmittel gegen das mechanistische Krankheitsbild zu berücksichtigen.
Die Zusammenfassung basiert auf dem Originalartikel und der deutschen Übersetzung mit freundlicher Genehmigung der Autoren.
Quelle
Andre Menache: Are Animal Models Relevant in Modern Psychiatry. Psychiatric Times 29: 3, 28. Februar 2012 (übersetzt von Dr. med. Alexander Walz, Oberarzt)
13. Dezember 2013
Eine aktuelle wissenschaftliche Studie lässt den Rückschluss zu, dass Alzheimer-Tierversuche nicht auf den Menschen übertragen werden können. Die Forscher folgern, dass Untersuchungen an menschlichen Nervenzellen sinnvoller sind und stellen in der Fachzeitschrift Stem Cell Reports ein entsprechendes Untersuchungsmodell vor.
In Versuchen an transgenen Mäusen, Zellen tierischer Herkunft wie Zellen aus dem Eierstock Chinesischer Hamster, aber auch in Tests an menschlichen Nierenzellen, führte die Gabe von bestimmten Medikamenten (nichtsteroidalen Antirheumatika) dazu, dass sich weniger Ablagerungen bildeten, die für das Absterben des umliegenden Nervengewebes und damit für die Entstehung von Alzheimer verantwortlich gemacht werden. In der Phase 2 und 3 der klinischen Studie am Menschen zeigte sich dieser Therapieansatz jedoch wirkungslos.
Wissenschaftler der Universität Bonn haben nun gemeinsam mit Forschern aus Belgien und den USA aus Hautzellen von Patienten, die an einer bestimmten Form von Alzheimer leiden, Nervenzellen hergestellt. Die Hautzellen wurden dazu in das embryonale Stadium zurückversetzt. Aus diesen sogenannten pluripotenten Stammzellen können sich fast alle Arten von Zellen bilden, wie in diesem Fall Nervenzellen. An den so gewonnenen Neuronen testeten die Wissenschaftler die nicht nichtsteroidalen Antirheumatika, die unter anderem in Tests an tierischen Zellen und transgenen Mäusen wirksam erschienen. Das Ergebnis der Untersuchung an den menschlichen Nervenzellen jedoch zeigte - wie die klinische Studie auch - keinen Therapieerfolg und war somit gegensätzlich zu den Befunden aus der tierexperimentellen Forschung.
Die Autoren folgern, dass sich die Stoffwechselvorgänge in nicht-neuronalen Zellen und solchen tierischer Herkunft von denen in menschlichen Nervenzellen unterscheiden und somit eine Übertragbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben ist. Da die Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments viele Jahre dauert, sehen die Wissenschaftler es als zielführend, patientenspezifische Neuronen zu Untersuchungszwecken heranzuziehen. Die Tests mit standardmäßig verwendeten transgenen Maus“modellen“ oder nicht-neuronalen Zellen haben zu einer Fehleinschätzung der Wirksamkeit der Medikamente geführt. Die Autoren der Studie empfehlen daher die Forschung an den jeweils relevanten menschlichen Zellen.
Die Studie verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig durchdachte und auf die menschliche Situation bezogene Forschung ist. Forschung am falschen Organismus oder an den falschen Zellen führt zu vollkommen irreführenden Ergebnissen, was letztlich den medizinischen Fortschritt aufhält.
Quelle
Jerome Mertens et al.: APP Processing in Human Pluripotent Stem Cell-Derived Neurons Is Resistant to NSAID-Based y-Secretase Modulation. Stem Cell Reports 2013: 1(6); 491-498
26. Februar 2014
Tierversuche zur Erforschung der Multiplen Sklerose taugen nichts. Dies geht aus einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) hervor, die im Januar 2014 im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht wurde. Bereits innerhalb unterschiedlicher Tier»modelle« der Multiplen Sklerose zeigt sich eine mangelnde Übertragbarkeit und im Vergleich zum Menschen reagieren diese komplett entgegengesetzt. Die Autoren stellen die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Situation beim Menschen in Frage.
Wissenschaftler der TiHo Hannover haben in Datenbanken verfügbare Daten von menschlichen Patienten sowie aus tierexperimenteller Forschung unter die Lupe genommen. Analysiert wurden Veröffentlichungen zu drei gängigen Tier»modellen« , bei denen die MS auf unterschiedliche Weise hervorgerufen wird. Bei der Experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE) werden Mäusen oder Ratten Proteine aus den die Nervenfasern umgebenden Myelinscheiden injiziert, wodurch das Immunsystem die Nervenzellen des eigenen Körpers attackiert. Bei der Theilervirus-Enzephalomyelitis wird bei Mäusen eine Virusinfektion des Zentralnervensystems hervorgerufen. Beim dritten »Modell«, dem transgenen Tumor-Nekrose-Faktor-überexprimierenden Mausmodell, werden die Mäuse so genmanipuliert, dass es zu einer Überproduktion des Tumor-Nekrose-Faktors kommt, der bei Entzündungsreaktionen eine zentrale Rolle spielt. Mittels statistischer Methoden haben die Forscher zudem ermittelt, wie viele der rund 20.000 Gene ein unterschiedliches Expressionsmuster (sog. differentiell exprimierte Gene) zeigen, wenn man die Daten von erkrankten und gesunden Menschen bzw. Tieren untersucht.
Wie die Auswertung ergab, gelingt es in Tierversuchen nicht, auf der Ebene einzelner Gene eine nennenswerte Übereinstimmung zur menschlichen Erkrankung nachzuweisen. Beim Menschen geht man bei MS von knapp 5000 differentiell exprimierten Genen aus. Im Vergleich zu den drei Tier»modellen« konnten jedoch lediglich zwölf übereinstimmende Gene gefunden werden, zudem verhielten diese sich komplett gegensätzlich. Alle zwölf Gene waren bei an MS erkrankten Menschen herunter-, in den Tiermodellen jedoch hochreguliert. Selbst zwischen den drei Tier»modellen« konnten nur 40 übereinstimmende Gene identifiziert werden.
Bei der Multiplen Sklerose handelt es sich um eine unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der körpereigene Abwehrzellen die Myelinscheiden der Nervenfasern angreifen und in Folge Entzündungen im Gehirn und Rückenmark entstehen. Tiere erkranken von Natur als nicht an MS. Im Tierversuch werden also lediglich auf künstliche Weise ähnliche Symptome hervorgerufen, die mit der menschlichen Erkrankung nichts zu tun haben, wie diese Studie erneut belegt.
Quelle
Barbara B. R. Raddatz et al.: Transcriptomic Meta-Analysis of Multiple Sclerosis and Its Experimental Models. PLOS ONE 2014: 9, e86643
27. März 2014
Die meisten Substanzen, die in Tests an Mäusen wirken, helfen Menschen nicht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die Ende 2013 im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde. Bei der Begutachtung einer Versuchsreihe an Mäusen zur Testung eines Medikamentes zur Behandlung von Schlaganfall offenbarte sich zudem, dass wichtige Ergebnisse unter den Tisch fallen.
An 20 Mäusen wurde ein potentielles Schlaganfall-Medikament getestet. 10 Tiere erhielten die Substanz und 10 ein Placebo. Die Studie kam zum Ergebnis, dass die Substanz wirkt und ein Erfolg ist. Der Neurologe Prof. Ulrich Dirnagl, Leiter des Zentrums für experimentelle Schlaganfallforschung an der Berliner Charité, hatte diese Studie überprüft und festgestellt, dass von den 10 Mäusen, die die Substanz erhielten, im Abschlussbericht nur noch 7 erwähnt werden. Auf Nachfrage erfuhr er, dass die 3 Mäuse frühzeitig an Hirnschlag starben und in der Auswertung nicht weiter berücksichtigt wurden. Hätten sie darin Eingang gefunden, hätte sich gezeigt, dass die Substanz mehr Schaden anrichtet als nützt, so das Fazit der Begutachtung. Die Art der Tierversuchsforschung bezeichnet Dirnagl als steinzeitlich.
Zahlreiche Forscher beklagen den mangelnden Nutzen von Tierversuchen. Prof. Malcolm Macleod von der Universität Edinburgh sichtete im Jahr 2004 Tierversuchsstudien zur Hirnschlag-Forschung. 603 Substanzen waren an Mäusen getestet worden, wovon 374 als wirksam eingestuft wurden. 97 davon wurden am Menschen getestet, wo jedoch nur eine einzige Substanz wirkte. Und diese hatte man nur ausgewählt, weil sie zuvor beim Menschen bei Herzschlag geholfen hatte.
Ähnlich untauglich zeigten sich Tierversuche zur Testung eines Medikaments gegen Amyotrophe Lateralsklerose, eine Erkrankung des motorischen Nervensystems. Alle 70 Substanzen, die sich an Mäusen bewährt hatten, versagten beim Menschen. Dieses Ergebnis deckt sich mit längst bekanntem Wissen. So zeigte eine Studie der amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) bereits 2004, dass 92% der potentiellen Medikamente, die sich im Tierversuch als wirksam und sicher erwiesen haben, nicht durch die klinische Prüfung kommen, weil sie gar nicht oder anders wirken oder aber schädlich für den Menschen sind.
Quelle
Jennifer Couzin-Frankel: When mice mislead. Science 2013: 342; 922-925
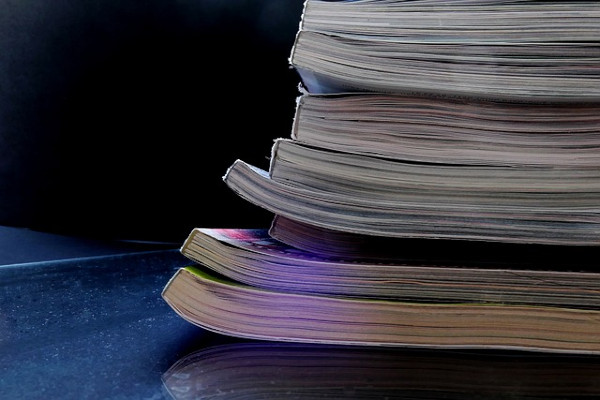
12. Juni 2014
Den Autoren einer im Mai 2014 in der medizinischen Fachzeitschrift British Medical Journal veröffentlichten Studie zufolge fehlt der Nachweis über den Nutzen von Tierversuchen und Gelder, die in die tierexperimentelle Forschung investiert werden, bleiben einer für Mediziner und Patienten sinnvollen Forschung vorenthalten.
Als Kernaussagen formulieren die Autoren,
- dass die Durchführung, Veröffentlichung und Darstellung von tierexperimenteller Forschung unzureichend ist
- die Situation unethisch ist, da Tiere und Menschen Teil eines Wissenschaftssystems sind, das keine verlässlichen Ergebnisse liefert
- der systematische Nachweis über den klinischen Nutzen von Tierversuchen mangelhaft ist
- eine größere Genauigkeit und Rechenschaftspflicht notwendig ist, um die sinnvollste Verwendung öffentlicher Gelder zu gewährleisten.
In der aktuellen Studie wurde die Literatur nach Hinweisen für den klinischen Nutzen von Tierversuchen durchforstet. Nur 25 Übersichtsarbeiten (Reviews) wurden gefunden, die die These untermauern, dass die tierexperimentelle Forschung eine medizinische Relevanz hat und selbst diese wenigen Veröffentlichungen ließen Zweifel an der Qualität und Aussagekraft aufkommen. Belege dafür würden sich häufen, dass mit Tierversuchen, wenn überhaupt, nur sehr dürftig Vorhersagen für den Menschen getroffen werden können.
Eine Auswertung des britischen Nationalen Zentrums für Ersatz, Verfeinerung und Verminderung von Tierversuchen (NC3Rs) hatte 271 Tierversuche, die zwischen 1999 und 2005 durchgeführt wurden, unter die Lupe genommen. Es zeigte sich, dass nur bei 32 der 271 Versuchen (12 %) der tierexperimentellen Arbeiten anerkannte Methoden des Studiendesigns angewendet wurden.
Eine Metaanalyse untersuchte systematisch Tierversuche hinsichtlich ihres Nutzens für den Menschen in den Bereichen Schlaganfall, neurologische Erkrankungen, Knochenkrebs, Multiple Sklerose und Parkinson. John Ioannidis, Professor für Gesundheitsforschung an der Stanford Universität, folgerte aus dieser Analyse, dass es nahezu unmöglich ist, sich auf Tierversuchsdaten zu verlassen, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis für den Menschen vorherzusagen.
Zahlreiche Studien lassen den Rückschluss zu, dass selbst Ansätze, die sich im Tierversuch als sehr vielversprechend gezeigt haben, in der klinischen Studie am Menschen versagen und keine praktische Anwendung daraus resultiert. Beispielsweise zeigt eine Auswertung, dass weniger als 10 % der als vielversprechend erscheinenden Entdeckungen aus der Grundlagenforschung innerhalb von 20 Jahren zu klinischen Anwendungen führen. So folgte aus jahrzehntelanger Schlaganfallforschung und enormen Investitionen keine einzige Therapie für den Menschen. Ähnlich bei Versuchen an einem „etablierten Mausmodell“ zur amyotrophen Lateralsklerose (Erkrankung des motorischen Nervensystems). Von über 100 Wirkstoffen, die sich im „Tiermodell“ als wirksam erwiesen haben, wurden 92 im weiteren Verlauf der Medikamentenentwicklung aussortiert. Die verbleibenden acht Medikamente wurden an Tausenden Probanden getestet, mit dem Ergebnis, dass sie nicht die erwartete therapeutische Wirkung hatten.
Die Autoren äußern, dass bei der großen Anzahl durchgeführter Tierversuche die Übereinstimmung einzelner Ergebnisse mit denen am Menschen purer Zufall ist. Sie gehen der Frage nach, ob eine bessere Qualität bei der Durchführung von Tierversuchen mehr Nutzen für den Menschen bringen würde. Mit Blick auf Studien, die diesem Anspruch genügen, zeigt sich jedoch unter anderem bei der Schlaganfallforschung, dass auch nach 10 Jahren keine klinisch relevanten Rückschlüsse gezogen werden konnten.
Ein Projekt an einer englischen Universitätsklinik zielte darauf ab, mit einer besseren Schulung der Experimentatoren die Übertragbarkeit von Tierversuchsergebnissen auf den Menschen zu verbessern. Allerdings zeigte sich, dass die Motivation der Grundlagenforscher vielmehr in der wissenschaftlichen Entdeckungslust begründet lag als in der Absicht, klinisch anwendbare Erkenntnisse zu erlangen.
Die Autoren der Studie bezeichnen die bestehende Situation als unethisch und kritisieren, dass schlechte Versuchsdesigns und methodische Ungenauigkeit bei vorklinischen Tests dazu führen, dass darauffolgende klinische Studien am Menschen versagen, Probanden potentiellen Risiken ausgesetzt werden und uns nützliche Therapien möglicherweise vorenthalten bleiben. Zudem sei es ethisch nicht zu rechtfertigen, Tieren in Versuchen, die ungenau durchgeführt werden und keine verlässlichen Ergebnisse liefern, Leid zuzufügen. Ebenso unethisch sei die Nicht-Veröffentlichung von Tierversuchsergebnissen, da dies dazu führe, dass Kenntnisse vorenthalten bleiben und folglich unnötigerweise weitere Tierversuche durchgeführt werden.
Originalveröffentlichung
Pandora Pound, Michael B. Bracken: How predictive and productive is animal research? BMJ 2014; 348:g3719
Artikel als PDF >>
19. Juni 2014
Eine Ende April 2014 in der Fachzeitschrift Nature Methods veröffentlichte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass männliche Experimentatoren Nagetiere derart in Stress versetzen, dass die Ergebnisse zusätzlich verfälscht werden. Durch den Stress vermeiden die Tiere Schmerzen zu zeigen. Dieser Umstand wird zwar seit langem vermutet, Experimentatoren aus Kanada gingen diesem Phänomen nun mittels weiterer Tierversuche nach.
Den Tieren wurde zum Vergleich von männlichen und weiblichen Experimentatoren eine Injektion in das Fußgelenk verabreicht und die Schmerzreaktion mittels der „Maus-Mimik-Skala“ bewertet. Männern gegenüber unterdrückten die Tiere ihren Schmerz um 40 %. Bei den Nagern wurde ein erhöhter Spiegel an Stresshormonen im Blut nachgewiesen. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich, wenn ein anderes männliches Tier wie Meerschweinchen, Ratten, Katzen und Hunde in der Nähe war. Nur bei Anwesenheit männlicher Käfiggenossen war dieser Effekt nicht nachweisbar.
Im sogenannten „Offenen-Feld-Test“ wurde zudem das Angstverhalten analysiert – Tiere, die das offene Feld meiden und sich am Rand aufhalten, gelten als ängstlich. Auch hier verursachte die Anwesenheit von Männern verstärkt Stress für die Tiere. Weiter wurde entweder ein T-Shirt mit Männergeruch in die Nähe der Tiere gelegt oder der männliche Achselgeruch in den Käfig der Tiere eingeleitet – in beiden Fällen waren die Schmerzäußerungen wiederum unterdrückt. Beim gleichen Versuch mit weiblichem Geruch zeigte sich kein Einfluss.
Die Experimentatoren werteten zudem vergangene Tierversuchstudien aus, bei denen es um die Schmerzempfindlichkeit auf heißes Wasser ging, und fanden heraus, dass Tiere, die von Männern behandelt worden waren, ihren Schmerz stärker unterdrückten als die von Frauen behandelten.
Für diese Erkenntnis wurde also eine Reihe von Tierversuchen durchgeführt. Anstatt aus dem bereits bekannten Wissen, dass die Übertragung der Tierversuchsergebnisse auf den Menschen bereits unabhängig vom Geschlecht des Experimentators einem Lotteriespiel gleicht, die Konsequenzen zu ziehen und tierversuchsfreie Forschungswege zu gehen, empfehlen die Autoren, dass bei der Veröffentlichung der Tierversuche das Geschlecht des Experimentators angegeben werden soll. Zudem wird vorgeschlagen, die statistischen Methoden dahingehend anzupassen, dass diese Variabilität ausgeglichen wird.
Diese Studie belegt aufs Neue, welch Zufallsprodukt die Ergebnisse von Tierversuchen sind und wie krampfhaft, nur des Ergründungseifers wegen, am Tierversuch geklammert wird.
Originalpublikation
Mogil, S. et al.: Olfactory exposure to males, including men, causes stress and related analgesia in rodents. Nature Methods, 2014: 11, 629–632, DOI: 10.1038/nmeth.2935
8. August 2014
Wissenschaftliche Studie fordert mehr Ursachenforschung
Zwischen den Ergebnissen aus Tierstudien für die Erforschung und Behandlung der Alzheimer-Krankheit und der klinischen Realität klafft eine große Lücke. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle, in der Fachzeitschrift ALTEX erschienene Übersichtsarbeit amerikanischer Wissenschaftler. Die Experten zeigen zudem einen Weg auf, von Tierversuchen wegzukommen und sich an Forschung am Menschen zu orientieren.
Zweiundzwanzig verschiedene transgene „Mausmodelle“ wurden entwickelt, die alle lediglich Teilaspekte der Alzheimer Krankheit darstellen. Bei Mäusen werden ein oder mehrere menschliche Gene in das Erbgut eingeschleust. Bei manchen Mäusen treten dadurch Plaques im Gehirn auf, andere zeigen Störungen des Hirnstoffwechsels und wieder andere leiden unter Gedächtnisverlust. Obwohl laut den Autoren über viele Jahrzehnte hinweg so viele „Modelle“ für die Alzheimer-Krankheit entwickelt worden sind, hat dies kaum zu einem Nutzen für die Humanmedizin geführt. Grund hierfür ist die mangelhafte Darstellung der klinischen Situation des Menschen an Tieren. Zudem wird beim Menschen Alzheimer zu einem großen Teil gar nicht durch genetische Faktoren ausgelöst.
Was bei Mäusen durch Genmanipulation erreicht wird, versucht man bei Ratten durch Injektion eines Giftes hervorzurufen. Das Gift Streptozotocin zerstört die Zellen der Bauchspeicheldrüse, wodurch es zu Symptomen der Zuckerkrankheit kommt. So geschädigte Ratten werden im Allgemeinen in der Diabetes-Forschung verwendet. Da die Tiere als Nebeneffekt Gedächtnisprobleme zeigen, werden sie auch von der Alzheimer-Forschung vereinnahmt. Auch an Hunden, Kaninchen und Affen wird mit künstlichen Mitteln versucht, Demenz-Symptome auszulösen.
Kein „Tiermodell“ ist jedoch in der Lage die komplexen Symptome der menschlichen Krankheit nachzuahmen. Die Folge ist, dass viele Behandlungsmethoden bei Tieren vielversprechend waren, beim Menschen aber auf ganzer Linie versagten. So werden in einer amerikanischen Datenbank mehr als 1.200 klinische Studien mit potentiellen Therapeutika gelistet, aber nur fünf davon wurden in den USA zugelassen (über andere Länder gibt der Artikel keine Auskunft). Eines davon wird wegen schwerwiegender Nebenwirkungen kaum eingesetzt. Die zugelassenen Arzneien führen nur bei 50 % der Patienten zu einer Besserung. Die Washingtoner Experten nennen 37 Wirkstoffe, die im Tierversuch erfolgreich waren, von denen 25 im Test am Menschen versagten, entweder wegen mangelnder Wirkung oder wegen schwerer unerwünschter Wirkungen. Sieben Mittel befinden sich zurzeit in klinischen Studien.
Zahlreiche Bevölkerungsstudien belegen Zusammenhänge zwischen dem Lebensstil und der Entwicklung von Demenzerkrankungen. So wirkt sich der Verzehr von Nüssen, Kohlgemüse, dunkelgrünem Gemüse und Obst positiv aus, während Fleisch, Butter und andere Milchprodukte die Entstehung von Alzheimer begünstigen können. Förderlich bei der Prävention von Demenz ist außerdem körperliche Bewegung. Neben einer verstärkten Erforschung der Ursachen und der Risikofaktoren fordern die Autoren eine Abkehr von der tierexperimentellen Alzheimerforschung zu Gunsten beispielsweise der Untersuchung an pluripotenten Stammzellen, d.h. Zellen die sich aus Gewebeproben von erwachsenen Menschen gewinnen lassen, um die Entwicklung von Therapiemöglichkeiten voranzutreiben.
Quelle
Sarah E. Cavanaugh, John J. Pippin, Neal D. Barnard: Animal Models of Alzheimer Disease: Historical pitfalls and a path forward. ALTEX 2014: 31(3), 279-302
20. Oktober 2014
Einer im März 2014 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Auswertung des ALS Therapy Development Instituts in Cambridge, Massachusetts, zufolge ist trotz jahrzehntelanger tierexperimenteller Erforschung der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS), einer schweren Erkrankung des motorischen Nervensystems, keine Therapie in Sicht.
Bislang sind nur ein Dutzend Wirkstoffe, die bei Mäusen die Symptome linderten, in klinischen Studien am Menschen getestet worden. Im Ergebnis versagten alle Wirkstoffe bis auf einen, und auch dieser zeigte in einer klein angelegten klinischen Studie für ALS-Patienten nur einen marginalen Nutzen. So verlängert Lithium die Überlebenszeit von SOD1-Mäusen, einer häufig verwendeten Linie, um 30 Tage. Bei drei weiteren klinischen Studien mit Hunderten Patienten und Kosten von 100 Millionen Dollar kam heraus, dass Lithium keinerlei therapeutischen Effekt hatte.
Symptome der ALS werden beispielsweise durch Genmanipulation an Tieren erzeugt, was jedoch die menschliche Erkrankung in ihrer Komplexität nicht abbilden kann. So stirbt die in der ALS-Forschung häufig verwendete Maus-Mutante TDP 43 an Darmverschluss, weil ihr Darm gelähmt wird. Menschliche Patienten dagegen sterben an Muskelschwund.
Um rückwirkend den möglichen Nutzen von ALS-Medikamenten zu überprüfen, wurden erneut Tierversuche an Mäusen durchgeführt. Dabei versagten alle der 100 in Tierversuchen als potentiell wirksam eingestuften Medikamenten am Menschen. Auch bei den acht Wirkstoffen, die in klinischen Studien an tausenden Patienten getestet wurden, bestätigte sich der am Tier gefundene positive Effekt nicht.
Der Autor der Studie kommt zu dem Schluss, dass auch in der ALS-Forschung Tierversuche oft von schlechter Qualität sind und viel Geld für irrelevante Forschung ausgegeben wird. Dennoch mussten für diese, nicht neue, Erkenntnis Tiere für Versuche herhalten.
Quelle und Originalpublikation
S. Perrin: Make mouse studies work. Nature 2014: 507; 423-425 (PDF) >>
25. Februar 2015
Die Autoren einer bereits in 2012 veröffentlichten Studie stellen Tierversuche im Zeitalter der „personalisierten“ Medizin kritisch in Frage und fordern, dass eine auf den Menschen bezogene Forschung im Vordergrund stehen sollte, um Erkenntnisse über menschliche Krankheiten sowie über Risiken bei der Einnahme von Arzneimitteln zu gewinnen. In der personalisierten Medizin soll eine für den Patienten maßgeschneiderte Therapie erfolgen, welche über das spezielle Krankheitsbild hinaus vor allem das individuelle menschliche Erbmaterial (Genom) und dessen Einfluss auf das Wirken von Medikamenten berücksichtigt. Das Verwenden von Tieren als „Modelle“ für die Grundlagenerforschung menschlicher Krankheiten würde die grundlegenden Prinzipien der personalisierten Medizin ignorieren. Das ist die zentrale Aussage der vorliegenden Studie.
Die Wissenschaft sei längst in Kenntnis darüber, dass sogar eineiige Zwillinge signifikante genetische Unterschiede aufweisen. Sogenannte regulatorische Gene und weitere Faktoren sind dafür verantwortlich, dass exakt gleiche Genome ein völlig unterschiedliches Erscheinungsbild der Merkmale eines Organismus (Phänotyp) aufweisen können. Die Autoren folgern daher, dass die Grundsätze für die personalisierte Medizin auf die Grundlagenforschung wie auch die Medikamentenprüfung übertragen werden müssen, um eine für den Menschen relevante Wissenschaft zu betreiben.
Zur Vorhersagekraft medizinischer Forschung
Aussagekräftige wissenschaftliche Analysen sollten eine hohe Wahrscheinlichkeit erreichen, eine möglichst korrekte Antwort im Hinblick auf die jeweilige Fragestellung zu geben. Eine eher zufällige Übereinstimmung sei dabei kein Synonym für die Prognosefähigkeit des durchgeführten Versuchs und somit wenig hilfreich.
Zu Unterschieden innerhalb einer Art
Die personalisierte Medizin basiere auf enormen Unterschieden in Krankheitsverläufen und Arzneimittelantworten zwischen menschlichen Individuen, trotz genetischer Ähnlichkeit. Über 90% der Arzneimittel wirkten nur bei 30-50% der Menschen. Die meisten Wirkstoffe zeigten zudem eine Effektivitätsrate von nur 50% oder weniger. Aufgrund genetischer Vielfältigkeit (Polymorphismen) sei es auch denkbar, dass beispielsweise ein Impfstoff nicht alle Individuen gleichermaßen schützen kann. Es wird angenommen, dass 5-20% der gegen Hepatitis B geimpften Menschen und 2-10% derjenigen, die gegen Masern geimpft wurden, bei einem entsprechenden Erregerkontakt nicht geschützt sind. Für die Zukunft sei es daher denkbar, dass Kinder personalisierte Impfstoffe erhalten werden.
Zu komplexen Systemen
Menschen und Tiere sind Beispiele für komplexe biologische Systeme, was im Umkehrschluss bedeutet, dass es als problematisch anzusehen ist, wenn Ergebnisse aus Medikamentenprüfungen und Krankheitsverläufen z.B. aus Ratten auf andere Systeme wie den Menschen übertragen werden. In jedem komplexen System können kleinste Abweichungen in den Ausgangsbedingungen drastische Unterschiede im Endergebnis erzeugen.
Zu Unterschieden zwischen den Arten
Tiere werden häufig „verwendet“, um die menschliche Antwort auf Medikamente und Krankheiten vorherzusagen. Empirisch gesehen sei das Übertragen von Forschungsergebnissen zwischen den Arten problematisch und die Prognosekraft würde nur eine unzureichende Wahrscheinlichkeit aufweisen. Alle Tiere seien Beispiele komplexer Systeme und wenn sogar die menschliche Population unterschiedliche Reaktionen zwischen den Individuen zeigt, sei es nicht verwunderlich, dass „Tiermodelle“ in ihrer Vorhersage für den Menschen weitgehend fehlschlagen.
Zur Evolution
Unterschiede in den Genen und vor allem der Genregulation erklärten die empirisch beobachtete geringe Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedene Arten in gleicher Weise auf eine Krankheit oder Wirkstoffe reagieren.
Zur Perspektive für die Zukunft
Die Autoren vertreten die Meinung, dass eine seriöse Wissenschaft zugunsten des Menschen zu einem sofortigen Ende von Tierversuchen führen müsse. Das NIH (nationales Gesundheitsinstitut der USA) wie auch andere Fördermittelorganisationen sollten in Erwägung ziehen, Forschungsgelder für Tierversuche vielmehr für eine auf den Menschen bezogene Forschung zu bewilligen.
Die Erforschung von Krankheiten direkt am Menschen oder menschlichen Geweben, die Entwicklung von unterstützender Software und generell das Verfolgen von grundsätzlichen Prinzipien der personalisierten Medizin seien die Wegweiser für die Zukunft.
Quelle
Ray Greek, Andre Menache and Mark J Rice (2012). Animal models in an age of personalized medicine. Personalized Medicine 2012: 9 (1), 47-64
https://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/pme.11.89






